
Sechs weiße Ledersessel statt Rednerpult, Rekordquote junger Frauen statt einer Phalanx grauanzügiger Herren, tänzelnde Polit-Conferenciers und Bühnendialog statt Vortragsmarathon. Die FDP gibt sich beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart alle Mühe, sich einen neuen Anstrich zu geben.
Das Augenfällige ist schnell geschildert. Mit Katja Suding (39) und Lencke Steiner (29) schickt die FDP zwei junge Spitzenkandidatinnen in die Bürgerschaftswahlen von Hamburg und Bremen in diesem Jahr.
Steiner, seit kurzem verheiratet, hat unter ihrem Mädchennamen Wischhusen als Bundesvorsitzende des Bundesverbandes Junger Unternehmer mit klar marktwirtschaftlichen Positionen und heftigen Attacken auf die große Koalition Aufsehen erregt. Nun will die Parteilose die Liberalen wieder ins Bremische Stadtparlament führen.







Neugier weckte die FDP-Parteiführung auch mit der gezielten (Des-)Information, die Freidemokraten verabschiedeten sich von ihrer traditionellen Farbkombination Blau-Gelb und kleideten sich künftig ins knallig-moderne Magenta, die Farbe der Deutschen Telekom (freilich ohne Parteispende).
Am Ende ist es gerade noch ein kleiner pinkfarbener Balken mit weißen Buchstaben, der die große gelbe Fläche mit der traditionellen blauen Schrift unterbricht. Als „Morgenröte“ interpretiert der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil die neue Kombination seiner Partei – aber noch ist nicht ausgemacht, ob es wirklich der Sonnenaufgang ist - und nicht die Farbe des Untergangs der liberalen Sache.
Der Vorsitzende Christian Lindner versucht einen Spagat: Seine Partei soll die liberale Partei bleiben, die sie immer sein wollte, aber nun modernisiert und runderneuert auftreten und damit jede Erinnerung an gebrochene Wahlversprechen der Regierungsperiode 2009 bis 2013 vergessen machen. Das heißt: neue Optik und neue Gesichter, und das inhaltliche Angebot soll gereinigt werden von Kompromiss-Verkrustungen und konturverwischenden Anpassungen an frühere Regierungspartner.
Nach dem Trauerjahr seit dem Rauswurf aus dem Bundestag im Herbst 2013 will Lindner nun in die neue Zeit starten. In 300 internen Veranstaltungen hat die FDP über ihre Vergangenheit und Zukunft diskutiert, 15.000 Mitglieder haben sich beteiligt. Dabei sei eine enorme Diskrepanz in der eigenen Wahrnehmung aufgeflogen.
Die Funktionäre, also insbesondere auch die früheren Abgeordneten, hätten die vielen kleinen Erfolge hervorgehoben, die die Partei im Kampf mit dem schwarzen Koalitionspartner errungen hatte. „Die Mitglieder haben vor allem den einen ausgebliebenen Erfolg gesehen“, berichtet Lindner in seiner Dreikönigsrede. Und das ist ja auch die Wahrnehmung der enttäuschen FDP-Wähler und Bürger: Ein einfaches und gerechtes Steuersystem hatten die Freidemokraten versprochen – aber nicht geliefert.
Lindner zeigt sich selbstkritisch
Also räumt der Vorsitzende zunächst die Versäumnisse der Vergangenheit ab. „Es war ein Fehler, dass wir bei den Koalitionsgesprächen 2009 nicht auf dem Finanzministerium bestanden haben“, watscht Lindner den damaligen Vorsitzenden Guido Westerwelle ab. Das gibt kräftigen Beifall von den auch in diesem Jahr voll besetzten Ringen.
Und Lindner legt selbstkritisch nach, denn auch als er schon – als Generalsekretär – Teil der Parteiführung war, hätten die Freidemokraten kapituliert: „Im Mai 2010 hat die Bundeskanzlerin die Pläne für eine große Steuerreform zurückgenommen, und die FDP hat dies widerspruchslos hingenommen. Dafür trage auch ich Verantwortung.“
Daraus will der heutige Parteichef für die Zukunft lernen. „Eher dass ein anderer das Fähnlein der Liberalen einrollt, gehen wir lieber selbst mit wehenden Fahnen von Bord. Die Selbstachtung lassen sich freie Demokraten niemals mehr nehmen.“
Kernpunkt ist künftig die Bildungspolitik
Im Gegensatz zu seinen Vorrednern hat Lindner nicht einmal Redekärtchen dabei (ein Rednerpult fürs ausgefeilte Manuskript gibt es ja nicht mehr), sondern spricht 70 Minuten frei über die Ziele seiner Partei und Politik. Das hat es unter deutschen Politikern lange nicht mehr gegeben. Um die neue, alte Zielrichtung seiner Partei zu beschreiben, greift Lindner zurück auf eine Erzählung Franz Kafkas. Der habe einen Mann beschrieben, der zeitlebens auf eine Tür geschaut habe, neben der ein Wächter stand.
Zeitlebens zögerte er, die Klinke herunterzudrücken und hindurchzugehen – obwohl er es so gern gewollt hätte. Kurz vor seinem Lebensende habe der Wächter sich bewegt, die Tür abgeschlossen und zu dem Mann gesagt: „Sie war die ganze Zeit offen, und sie war nur für Dich bestimmt.“ Da geht ein Raunen durch den großen Saal des Staatstheaters.
Es ist die Stimmung, die er erzeugen wollte, die Lindner nun fast triumphierend hervorstoßen lässt: „Das ist die Aufgabe der FDP: Den Menschen Lust und Mut machen, ihre Freiheit zu nutzen. Wenn die anderen sagen: ‚Du kannst nicht, Du sollst nicht‘ - dann sagen wir: Klar kannst Du, wir vertrauen auf Deine Fähigkeiten.“
Die modernen Zeiten machten den Menschen immer kleiner, durch Bürokratie, die entfesselten Kräfte der Kapitalmärkte, Digitalisierung, Meinungsdruck. Die Liberalen versprechen: „Wir machen Dich größer, nicht den Staat.“ So ganz neu ist das nicht. Und so sagt Lindner auch, seine Partei wolle ihre Grundüberzeugungen nicht verwässern und verschlanken, sondern die Dosis erhöhen: „Nicht FDH, sondern FDpur.“
Was das konkret bedeuten soll, macht Lindner an drei Beispielen deutlich.
Liberale Erzählung
Kernpunkt der „liberalen Erzählung“ solle künftig nicht mehr die Wirtschafts-, sondern die Bildungspolitik sein, verbunden mit einer liberalen Erziehung. Sie sei die Grundlage der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung. Die Eliteunis in den USA seien die Kaderschmieden der künftigen Nobelpreisträger.
„Wenn wir uns mit Mittelmaß zufrieden geben, dann werden wir künftig nur noch mittelmäßig leben.“ Das weltbeste Bildungssystem sei gerade gut genug. Deshalb dürfe es nicht länger bei der föderalen Kleinstaaterei bleiben. „Bildung ist eine Frage des Gesamtstaats.“
Es dürfe nicht mehr sein, dass 16 Bundesländer darüber stritten, wer welche bildungspolitische Mode besonders bürokratisch umsetze. Auch müsse die Ausstattung der Schulen modernisiert werden. Da habe sich seit Jahrzehnten kaum etwas geändert. „Auf dem Schulhof ist die Zukunft, wenn sich die Kinder über die neusten Apps austauschen. Und dann geht es ins Klassenzimmer, zurück in die Kreidezeit.“ Doch statt mehr Geld für die kommende Generation bereitzustellen, habe die Bundesregierung „230 Milliarden im Rentensystem versenkt“.
Viel gefährlicher sei aber, dass Leistung nicht wertgeschätzt würde. So habe ihn kürzlich ein Radio-Moderator gefragt, ob er in der Schule wohl ein Streber gewesen sei. Er habe sich bei der Antwort unsicher gewunden – und sich später gefragt: Was sagt die Frage über unsere Gesellschaft aus? „Wenn das Streben nach Leistung zu einem Charakterfehler umgedeutet wird, dann muss man sich wehren und unsere Kinder und Jugendlichen davor schützen.“
„Liberale Wirtschaftspolitik muss einen Anspruch haben“
Als zweites Beispiel nennt Lindner die Offenheit für technologische Chancen, ohne die Rechte der Bürger zu gefährden oder einzuschränken. Die elektronische Patientenakte sei sinnvoll, damit im Notfall bekannt ist, welche Diagnose der Mensch habe und im Normalfall Doppeluntersuchungen vermieden werden könnten.
Aber alles müsse so geregelt werden, dass der Patient die Hoheit über seine Daten behalte. Niemals dürfe es passieren, postuliert Lindner, „dass eine Versicherung die DNA ausliest und danach ihren Tarif kalkuliert“. Bei allen technologischen Veränderungen sei entscheidend, dass die Bürger „selbstbestimmt die Vorteile der Digitalisierung nutzen“.
Nicht neu ist Lindners Klage, dass Deutschlands Bürokratie den technischen Fortschritt behindere. „Der deutsche Steve Jobs wäre bereits an der Baunutzungsverordnung seiner Garage gescheitert. Ich will nicht in einem Land leben, das mehr Bedenken als Garagen hat.“
Er beobachte eine zunehmende Entfremdung gegenüber der industriellen Basis des Landes. Die Lautstärke des Protestes entscheide oft über eine Technologie, nicht das wissenschaftlich geprüfte Argument. „In Deutschland ist schon das Wort Fracking giftiger als die Technologie selbst. Es ist unverantwortlich nicht wissen zu wollen, welche Chancen diese Technologie bietet.“
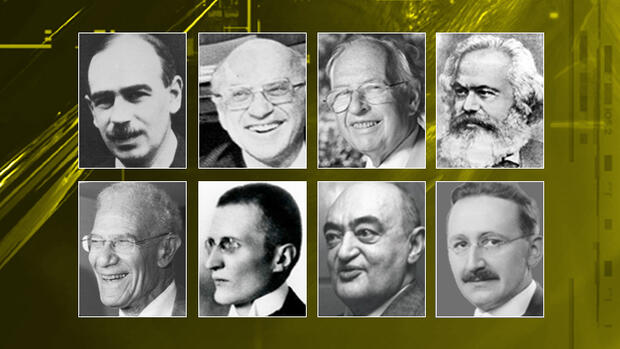

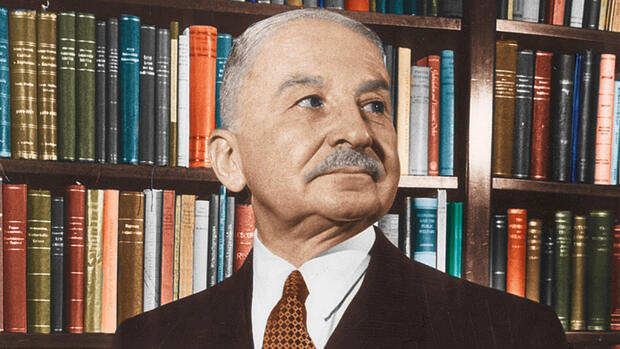
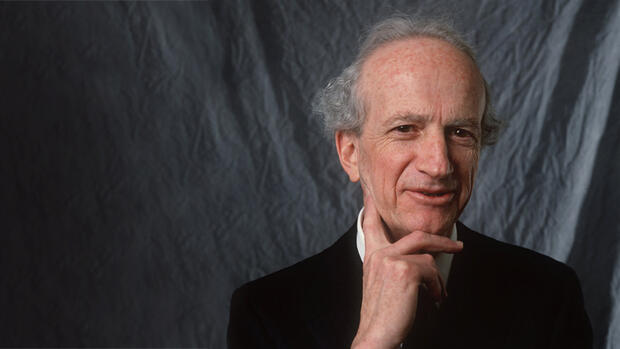



Schließlich müsse die FDP auch wieder für mehr Wettbewerb eintreten. So müsse der neue Taxi-Wettbewerber Uber in den deutschen Markt kommen können. Viele Kollegen in der Parteiführung hätten ihn vor diesem Vorstoß gewarnt, schließlich sei das Taxigewerbe gut organisierter Mittelstand.
„Aber liberale Wirtschaftspolitik muss einen anderen Anspruch haben“, ruft der Parteivorsitzende. „Wir können keiner Branche ihre Zukunft garantieren. Aber wir können fairen Wettbewerb organisieren. Damit die Menschen entscheiden können zwischen Newcomern und Etablierten.“
Zum Abschluss wendet sich Lindner entschieden gegen die Alternativ für Deutschland und die Pegida-Bewegung. Die Sorgen der Menschen müsse man ernstnehmen, denn man könne „den Bürgern ihre Alltagsbeobachtung nicht gelingender Integration nicht ausreden. Wer die Menschen, die Sorgen haben, pauschal als Nazis in Nadelstreifen beschimpft, der treibt sie in die Arme der falschen Leute.“ Mit den Pegida-Organisatoren und der AfD hätten die Freidemokraten nichts gemein. „Welches Abendland verteidigen die denn da? Das Abendland, das ich kenne, ist geprägt durch die Aufklärung und unsere wunderbare liberale Verfassung.“
Radikale Eiferer von allen Seiten müssten gestoppt werden. Entsprechend fordert Lindner von „den Muslimen in unserem Land, dass sie sich gegen jede Form des Extremismus wenden“. Es sei nicht zu tolerieren, wenn Salafisten bei Grillfesten in der Bonner Rheinaue Gotteskrieger für den Dschihad rekrutierten. „Salafisten und Pegida gefährden gleichermaßen die Offenheit der Gesellschaft.“
Gerade eine liberale Partei dürfe es nicht zulassen, dass mit Ressentiments Politik gemacht werde, wenn Islam gleich Islamismus gesetzt werde. „Wer ist dann der nächste? Die Zahnärzte, weil sie sich angeblich die Taschen vollmachen? Das kinderlose Paar? Wer heute wegschaut, kann morgen schon das nächste Opfer sein.“






















