
Herr Abelshauser, den Ökonomen wird derzeit oft vorgeworfen, mit ihren mathematischen Methoden an der Realität vorbei zu forschen. Die gegenwärtige Krise hat kaum einer vorhergesehen. Schlägt jetzt die Stunde von Wirtschaftshistorikern wie Ihnen?
Es gibt dramatische Unterschiede zwischen den Ökonomen, deren Horizont nur drei Monate zurückreicht, und den anderen, die gewohnt sind, über gegenwärtige Bedingungen in längerer historischer Perspektive zu urteilen. Die meisten Entscheidungen sind nämlich durch frühere Entscheidungen schon weitgehend festgelegt.
Sie meinen das, was Historiker Pfadabhängigkeit nennen.
Ja. Und die beachten viele Ökonomen nicht. Mit ihren Methoden, die ich als Denkhilfen durchaus respektiere, könnten sie besser das Wetter vorhersagen als die wirtschaftliche Entwicklung. Denn dazu gehören nicht nur statistische und mathematische Regelmäßigkeiten. Da gehören auch Denk- und Handlungsweisen der Menschen dazu, Spielregeln und historisch gewachsene Organisationsweisen der Wirtschaft, die sich von einem Land zum anderen deutlich unterscheiden. Das kann man mit herkömmlichen ökonomischen Modellen nicht erfassen. Deswegen können wir Wirtschaftshistoriker – sofern wir auch Ökonomen sind – Krisen wie die aktuelle besser analysieren.
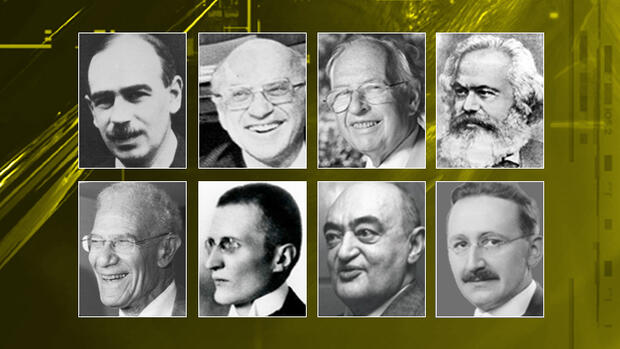

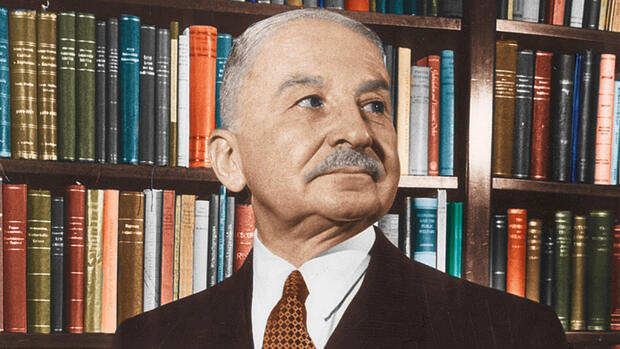
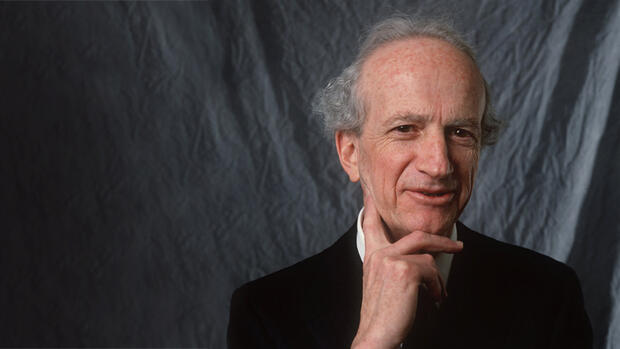



Ist es frustrierend, dass Politiker und Journalisten trotzdem immer auf die Konjunkturforscher hören und nicht auf die Historiker?
Ein wenig. Aber ich kann verstehen, dass die Politik lieber jemandem zuhört, der behauptet, ein Modell für die wirtschaftliche Zukunft zu haben. Es ist ja auch durchaus was dran an der Konjunkturforschung. In normalen Zeiten kann man mit solchen Modellen schon eine Menge anfangen.
Aber wenn es wirklich darauf ankommt, funktionieren die Prognosemethoden nicht.
Nicht einmal in normalen konjunkturellen Abläufen. Die entscheidende Frage, wo die Wendepunkte von Auf- und Abschwung liegen werden, ist bisher selten richtig beantwortet worden.

Kultur und Geschichte kommen in den Formeln der Ökonomen nicht vor. In Ihrem neuen Buch "Kulturen der Weltwirtschaft" sagen Sie, dass dies aber ausschlaggebend sei für Wettbewerbsvorteile.
Grundsätzlich unterscheide ich drei Ebenen. Die erste ist die der individuellen Mentalitäten. Das war im 19. Jahrhundert der große Renner: Der Grieche ist faul, der Deutsche fleißig, der Spanier stolz. An Stammtischen und auch an manchem Redaktionstisch ist das heute noch ein Thema. Aber dieser Blick auf wirtschaftliche Sekundärtugenden ist wenig hilfreich. Zumindest in Europa sind die individuellen Mentalitäten nämlich relativ ähnlich. Der italienische Arbeiter ist nach meiner Erfahrung nicht weniger fleißig als der deutsche, eher im Gegenteil. Produktiv und innovativ kann ein Mensch ohnehin nur in einer funktionierenden Gesellschaft werden. Das führt mich zur zweiten Ebene, nämlich den kollektiven Mentalitäten: Gibt es einen funktionierenden Staat? Werden Mechanismen der Inflationsbegrenzung akzeptiert? Da gibt es große Unterschiede in Europa, die sich aus der historisch gewachsenen Organisation von Staat und Gesellschaft erklären.
"Wirtschaftskulturen ändern sich nicht so einfach"







Das heißt, die Menschen müssen sich einig sein, dass es wichtig ist, zum Beispiel ein Defizit einzuschränken. Und das kann man nicht durch Gesetze erreichen?
Man kann es versuchen, zum Beispiel durch den Vertrag von Maastricht und den Fiskalpakt. Aber so etwas funktioniert in der Regel nicht, weil hinter diesen gesellschaftlichen Mentalitäten noch eine dritte Ebene kommt, nämlich handfeste, sehr widerstandsfähige Wirtschaftskulturen. Mit Gesetzen ist da nichts zu erreichen, da ist Hopfen und Malz verloren.
Man könnte dagegen einwenden, dass wir längst auf dem Weg in eine gemeinsame, globale Kultur sind, die auch die Wirtschaft umfasst.
Es gibt zweifellos eine globale Popkultur. Und wenn Sie durch die Städte gehen, so sehen die Geschäfte überall auf der Welt zum Verwechseln ähnlich aus. Aber das trifft nicht auf die Organisationsweise der Wirtschaft zu, wie wir in unserem aktuellen Buch zeigen. Je globaler die Märkte zusammenhängen, desto wichtiger wird es, komparative Vorteile zu entwickeln. Bei der Wirtschaftskultur, wie ich sie verstehe, geht es nicht um den Einzelnen und nicht um Gesellschaft und Staat, sondern um die Organisation der Wirtschaft und die Denk- und Handlungsweisen ihrer Akteure. Die Unternehmer, die Gewerkschafter, auch die Konsumenten akzeptieren einfach in manchen Regionen der Welt besondere Spielregeln, weil sie sich davon Vorteile versprechen. Und diese ändern sich nicht so einfach. Die Banken haben in Deutschland und Mitteleuropa zum Beispiel die historische Erfahrung gemacht, dass es für unsere Wettbewerbsfähigkeit gut ist, über geduldiges Kapital zu verfügen. Dass es gut ist, eine langfristige unternehmerische Perspektive zu finanzieren.
Aber hat sich das nicht gerade geändert? Ist die Deutschland AG nicht passé?
Wir haben noch die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken - fast 60 Prozent des Bankensystems. Und die bringen diese Geduld immer noch auf. In England und Amerika ist das sehr selten. Deren komparativer Vorteil ist das Risikokapital – was auf vielen Märkten ebenfalls wichtig ist. Man kann nicht sagen, die einen sind schlechter organisiert als die anderen. Das deutsche Bankensystem ist so wie es ist, weil die hiesige Produktionsweise es so erfordert. Das ist historisch so gewachsen: Wir sind auf nachindustrielle Maßschneiderei ausgerichtet, und die braucht eine langfristige Finanzierung. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht.







Schauen wir mal auf die Eurozone. Was unterscheidet die deutsche Wirtschaftskultur von der der Mittelmeerländer?
Da kann man weit zurückgehen. Seit rund tausend Jahren gibt es die Handelsachse der Hanse von Flandern über Skandinavien bis Nowgorod. Dann gibt es ebenfalls seit vielen Jahrhunderten die Achse von Flandern über die Champagne nach Genua und die von Flandern über Köln, Frankfurt, Augsburg und Nürnberg nach Venedig. Das sind gewachsene Wirtschaftsräume, die zu einer Vereinheitlichung des Denkens und Handelns geführt haben, also zu einer relativ einheitlichen Wirtschaftskultur. Deutschland ist also eingebettet in eine gewachsene Wirtschaftskultur, die von Skandinavien bis Norditalien, von der Seine bis an die Oder reicht. Die Entstehung ihrer heute noch gültigen Ausprägung kann man ziemlich genau festmachen in der langen Depression von 1873 bis 1896. Es war keine Depression der Löhne und Arbeitsmärkte, sondern eine der Renditen. Da das ausländische Kapital Deutschland verließ und es wenige investitionswillige Wirtschaftsbürger gab, mussten die Universalbanken die langfristige Finanzierung der neuen Industrien übernehmen. Und dann veränderten sich auch die Arbeitsbeziehungen spätestens in den 1890er Jahren mit dem Aufstieg der Gewerkschaften und der Einführung der Mitbestimmung. Denn die neuen Industrien, die Chemie, die Elektrotechnik, der Maschinenbau brauchten qualifizierte Arbeiter. Hire and Fire kam da teuer zu stehen. Die von Bismarck für die Sozialversicherung eingeführten paritätischen Ausschüsse wurden daher zu Mitbestimmungsgremien – ohne gesetzliche Grundlage übrigens, die kam erst 1920.
Und wie sieht es nun südlich von Genua aus?
Ich will nicht behaupten, diese Länder hätten keine Wirtschaftskultur. Sie haben eine andere. Nur funktioniert sie gegenwärtig nicht allzu gut. Die südeuropäischen Krisenländer haben eines gemeinsam, nämlich die Schwäche des Staates und der Gesellschaft. Die Ursache dafür liegt in rückständigen feudalen Strukturen und im Falle Griechenlands und Süditaliens außerdem in jahrhundertelanger Fremdherrschaft, die dazu führte, dass der Staat als Feind betrachtet wurde. Und wenn der Staat schwach ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Unter solchen Bedingungen fällt es schwer, Haushaltslöcher zu stopfen, die Staatsverschuldung zu bremsen oder die Korruption zu bekämpfen. Nicht zufällig haben all diese Länder faschistische Diktaturen erlebt. Die Faschisten wollten die Schwäche des Staates durch autoritäre Ordnung überwinden. Sie scheiterten. Die Europäische Gemeinschaft hat diese Länder an sich gebunden, damit sie nicht zurückfallen in autoritäre Politikmuster.
"Man hat zu sehr auf die Ökonomen gehört

Leidet die europäische Einigungspolitik also unter Geschichtsblindheit?
Man hat zu sehr auf die Ökonomen gehört. Die sagten, das kriegen wir schon hin, wir öffnen die Märkte, investieren, und dann wird sich alles angleichen. So kam es aber nicht, und man hätte es wissen können. Aus der Erfahrung Italiens. Dessen Eliten sind seit 150 Jahren nicht in der Lage, das Land zu vereinheitlichen. Kollektive Mentalitäten ändern sich nicht so einfach – die Wirtschaftskultur sowieso nicht.
Aber es gibt doch durchaus positive Beispiele aus der Wirtschaftsgeschichte.
Das beste Beispiel ist Japan. Japan hatte auch vor der Öffnung des Landes und der Meiji-Restauration eine funktionierende Wirtschaftskultur. Aber sie war international nicht wettbewerbsfähig. Und das haben die Japaner sofort verstanden, als 1853 die amerikanischen Kanonenboote vor ihrer Küste aufkreuzten. Da haben sie gewaltige Arbeit geleistet, Studiengruppen in die ganze Welt entsandt und sich informiert, wie man das Land und die Wirtschaft besser organisieren kann. Die größte Leistung war, alles im Rahmen der japanischen Traditionen laufen zu lassen. Denn eine Wirtschaftskultur kann man nicht gegen starken Widerstand aufzwingen, das geht nicht. Sie muss mit den herrschenden Denkweisen kompatibel und für die Menschen akzeptabel sein.
Die Japaner haben es aus eigener Kraft geschafft, zur Wirtschaftsgroßmacht zu werden. Den Südeuropäern wird durch die Kohäsionsfonds der EU seit vielen Jahrzehnten von den Mittel- und Nordeuropäern geholfen. War das vielleicht sogar ein Fehler?
Das Problem ist nicht die Hilfe an sich, sondern wie geholfen wird. Bis jetzt glauben die Europäer, Harmonisierung sei der Weg zum Erfolg. Aber auf der Ebene der Wirtschaftskulturen ist das falsch. Man muss feststellen, wo die Vorteile unserer Wirtschaftskulturen liegen – und zwar auf ihre jeweiligen Märkte bezogen. Und dann muss man sie stärken, auch wenn dies differenzierte Strategien der Wirtschaftspolitik erfordert. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Brüssel wäre damit völlig überfordert.
Und was machen wir nun mit einem Land wie Griechenland?
Es ist keine Lösung, Griechenland aus der EU zu werfen. Ich denke, man könnte Griechenland im Rahmen der EU helfen, Staat und Gesellschaft zu stärken – obwohl ich nicht weiß, wie genau das gehen soll. Aber eine Wirtschaftskultur wie die griechische in die Disziplin einer Hartwährungsunion einzubinden, das ist völlig absurd.
Die Instrumente zur Euro-Rettung
Pro: Mit einer gemeinsamen Einlagensicherung und mit einem EU-weiten Sicherheitsnetz für Europas Banken könnte zwei bedrohlichen Szenarien vorgebeugt werden: einem Bank-run, bei dem die Sparer panisch ihre Einlagen von der Bank abheben. Und der Gefahr, dass nationale Auffangfonds nicht ausreichen, um nationale Banken zu stützen.
Contra: Gesunde Banken, allen voran in Deutschland, müssten im Ernstfall für ihre maroden Konkurrenten in anderen Euroländern zahlen. Außerdem gibt es noch keine effiziente europäische Bankenaufsicht. Damit gelten für die Banken noch unterschiedliche Voraussetzungen - und es besteht keine Möglichkeit, die Geldhäuser zu kontrollieren und Abwicklungen und Restrukturierungen zu erzwingen.
Wahrscheinlichkeit: nur vorhanden, wenn es vorher eine effiziente europäische Bankenaufsicht gibt. Das soll die Europäische Zentralbank übernehmen. Wenn dazu eine überzeugende Einigung gelingt: 60 Prozent.
Pro: Mit direkter Bankenhilfe aus dem ESM oder von der EZB wären Krisenländer wie Spanien ihr größtes Problem los: dass nämlich Notkredite der Europartner die Schuldenlast das Staatshaushaltes und damit die Pleitegefahr deutlich erhöhen. Der Rettungsfonds könnte den Banken direkt Sicherheiten zur Verfügung stellen, mit denen diese das notwendige Geld zur Rekapitalisierung aufnehmen. Im besten Fall verdient der ESM daran, weil er das Geld billiger aufnimmt als verleiht.
Contra: Bei direkter Bankenhilfe hätten die Euroländern keine Möglichkeit, Gegenleistungen von den Regierungen zu erzwingen. Zudem wäre nicht garantiert, dass die Banken die Unterstützung zurückzahlen, wenn kein Staat dahinter steht. Unklar ist überdies, wie Auflagen für die Banken selbst durchgesetzt werden sollten.
Wahrscheinlichkeit: Siehe BANKEN-UNION: ohne eine effiziente europäische Bankenaufsicht gleich null. Nach Aufbau einer europäischen Aufsicht: 70 Prozent.
Pro: Dahinter verbirgt sich die Idee gemeinsamer Staatsanleihen, die von den Ländern der Eurozone ausgegeben würden. Ihr Reiz läge darin, dass alle Staaten zusammen für die Rückzahlung haften und sich so gegenseitig Rückendeckung geben. Dadurch könnten selbst von den Anlegern geschmähte Euro-Sorgenkinder wie Spanien, Italien und Griechenland wieder zu günstigeren Zinsen an frisches Geld kommen - und so ihre schwächelnde Konjunktur ankurbeln. Befürworter wie Frankreich hoffen, dass damit der Teufelskreis aus steigenden Staatsschulden und höheren Zinsen ein für alle Mal durchbrochen und ein abschreckendes Signal an Spekulanten ausgesendet wird.
Contra: Vergleichsweise solide haushaltende Staaten wie Deutschland, dessen Bundesanleihen bei Investoren als sicherer Hafen gelten und deshalb ein historisches Zinstief erreicht haben, müssten bei der Ausgabe gemeinsamer Euro-Bonds wieder höhere Renditen in Kauf nehmen - und somit Milliarden draufzahlen. Gegner monieren zudem fehlende Reformanreize für hoch verschuldete Staaten, weil großzügige Ausgabenpolitik die eigene Bonität nicht mehr direkt beeinträchtigen würden. Sie lehnen auch eine gesamtschuldnerische Haftung ab - denn beim Ausfall eines Schuldners müsste das Kollektiv, also Deutschland wie jedes andere Land, komplett für dessen Verbindlichkeiten haften.
Wahrscheinlichkeit: tendiert auf absehbare gegen Null Prozent, wegen des vehementen Widerstands der Bundesrepublik und anderer Nordländer.
Pro: Euro-Bills sollen die Kritiker der Euro-Bonds beschwichtigen, weil sie eine kürzere Laufzeit haben und in der Summe begrenzt wären. Mit ihrer Hilfe dürfte sich jeder Staat nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz seiner Wirtschaftsleistung finanzieren. Wer die damit verbundenen Haushaltsregeln nicht einhält, würde im Folgejahr vom Handel mit den Papieren ausgeschlossen. Die Idee wurde in EU-Kreisen als Kompromiss lanciert, weil sich vor allem Berlin stoisch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts beruft, das eine in Dauer und Höhe unbegrenzte Schuldenübernahme untersagt.
Contra: In Diplomatenkreisen werden die Euro-Bills als kleine Brüder der Euro-Bonds belächelt. Das erhoffte überwältigende Signal an Märkte und Spekulanten, dass Wetten gegen Euro-Staaten zum Scheitern verdammt sind, wären sie jedenfalls nicht mehr. Da Volumen und Laufzeit begrenzt sind, stellt sich zudem die Frage, ob sie die Nöte hoch verschuldeter Euro-Sorgenkinder unter steigendem Zinsdruck überhaupt effektiv zu lindern.
Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent, weil Euro-Bills weder für die Befürworter noch für die Gegner gemeinschaftlicher Staatsanleihen die erhoffte Lösung wären.
Pro: Mit einem Schuldentilgungsfonds, wie ihn die fünf deutschen Wirtschaftsweisen vorgeschlagen haben, würden nur nationale Verbindlichkeiten jenseits von 60 Prozent gemeinschaftlich und zu niedrigen Zinsen bedient - also erst über der Marke, die der EU-Stabilitätspakt gerade noch zulässt. Bis zu dieser roten Linie müssten die Länder weiterhin alleine für ihre Schulden gerade stehen, andere Euro-Staaten also nicht für die gesamte Schuldensumme ihrer europäischen Partner haften. Der zu gründende Fonds würde sich selbst an den Finanzmärkten refinanzieren und dort über eine kollektive Haftung aller Mitgliedstaaten abgesichert.
Contra: Während neben der SPD und den Grünen zuletzt auch das Europäische Parlament und der Internationale Währungsfonds Sympathien für diese Lösung bekundet haben, hegt die Bundesregierung verfassungsrechtliche Zweifel. Koalitionspolitiker sehen in ihr den Einstieg in die Vergemeinschaftung von Schulden, wie sie die No-Bailout-Klausel der europäischen Verträge verbiete. Die Bundesbank empfindet schon die Bezeichnung "Schuldentilgungspakt" als missverständlich, weil damit keine harten Einsparauflagen und Überschüsse zur Rückzahlung der Staatsschulden einhergingen.
Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent, da der Tilgungsfonds letztlich zwar ebenfalls die Übernahme fremder Schulden bedeutet, allerdings zu einem geringeren Umfang als bei Euro-Bonds oder Euro-Bills.
Pro: Mit der Ausgabe dieser Projektanleihen sollen in der EU bis Ende 2013 Privatinvestitionen von rund 4,5 Milliarden Euro mobilisiert werden. Dafür stünden in einer Pilotphase zwar nur 230 Millionen Euro aus dem EU-Budget zur Verfügung, Brüssel hofft jedoch auf einen 20-fachen Hebelfaktor: Mit der Europäischen Union im Rücken sollen Investoren kreditwürdiger erscheinen, dadurch an billigeres Geld kommen und so grenzüberschreitende Verkehrs- oder Energieprojekte finanzieren. Es bestünde also die Hoffnung, mit relativ geringem Risiko einen beachtlichen Effekt zu erzielen.
Contra: Skeptiker halten dem entgegen, dass sich für ökonomisch sinnvolle Projekte meist auch ohne staatliche Hilfe Privatinvestoren finden. Außerdem gebe es bislang lediglich eine Hand voll konkreter Vorhaben, die zudem nicht alle besonders ausgereift konzipiert seien.
Wahrscheinlichkeit: 95 Prozent, da eine informelle Einigung bereits Ende Mai erzielt wurde und die einzusetzenden Mittel in einem günstigen Verhältnis zum erhofften Nutzen stünden.
"Eine gesamteuropäische Alternative zum Euro"

Muss auch für den Rest Europas der Fehler Währungsunion korrigiert werden?
Die Politik folgt ihrer eigenen Pfadabhängigkeit, wenn es um Europa geht. Die Regierungen werden erst handeln, wenn sie von den Verhältnissen gezwungen werden. Wenn der Leidensdruck sehr groß ist, werden sie rasch handeln müssen. Denn wenn der Euro unkontrolliert auseinanderfällt, geht das große Hauen und Stechen los. Das wäre eine Katastrophe.
Was meinen Sie konkret mit Handeln?
Eine Alternative zum Euro schaffen. Und in diesem Fall sollte die deutsche Regierung nicht sagen: Wir kehren zur DM zurück. Sondern: Wir wollen die währungspolitische Spaltung Europas überwinden, indem wir ein gesamteuropäisches Währungssystem schaffen, das Euro- und Nichteuro-Länder umschließt. Dieses System wäre auf nationalen Währungen begründet, die durch festgelegte Kurse verbunden sind. Natürlich muss man vorher geschickt vorfühlen, damit möglichst viele Länder mitmachen. Vielleicht würden ja die Finnen diese Arbeit für uns übernehmen.
Würde die zu erwartende Aufwertung der deutschen Währung dann nicht auf Kosten der Exportindustrie gehen?
Nein, das ist ein Denkfehler vieler Ökonomen: Wenn Deutschland seine Währung aufwerten würde, sei die Wettbewerbsfähigkeit im Eimer. Das ist nicht wahr. Wir haben es ja im Europäischen Währungssystem vor der Euro-Einführung mehrfach erlebt. Zwischen 1978 und 1999 ist Frankreich fünf Mal und Italien vier Mal aus dem System ausgestiegen, um den Franc oder die Lira deutlich abzuwerten. Wir haben selbst mehrmals aufgewertet. Und daran ging unsere Wirtschaft nicht zu Grunde. Die Deutschen konkurrieren eben nicht über den Preis. Sie stellen maßgeschneiderte Qualitätsprodukte her, die kaum ein anderer herstellen kann. Und wenn die teurer werden, werden sie trotzdem gekauft. Die Wirtschaft braucht nicht den Euro, sondern kalkulierbare Kurse.
Und die offizielle Marschrichtung der Bundeskanzlerin, die Währungsunion zu retten und Souveränität nach Brüssel abzugeben?
Vielleicht hätte das kurzfristig eine gewisse Disziplinierungswirkung. Aber an den wirtschaftskulturellen Unterschieden in der Eurozone wird dieses riskante und teure Manöver kein Jota ändern. Wir können Europa nur weiterentwickeln, wenn wir diese Besonderheiten beachten. Sonst funktioniert es nicht.





















