
Grau hängt der Nebel an diesem nasskalten Dezembertag über Zürich und verhüllt das umliegende Bergpanorama. Doch das miese Wetter kann Rolf Pfeifer die Laune nicht verderben. Der 66-jährige Physiker und Mathematiker, der an der Universität Zürich seit 1987 das Labor für Künstliche Intelligenz (KI) leitet, ist gerade aus Paris zurückgekehrt. Er hat dort die französische Ausgabe seines Buchs "The Revolution of Embodied Intelligence" vorgestellt.
Pfeifer ist eine Koryphäe der KI-Forschung. Zu seinen besten Freunden zählt Rodney Brooks, legendärer Roboterpionier am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Als einer der Ersten erkannte Pfeifer, dass sich Verstand nicht von außen als fertiges Computerprogramm einhauchen lässt. Der Geist brauche einen Körper, um sich entfalten zu können, proklamierte der Schweizer Vordenker schon in den Neunzigerjahren – und kam so zu den Robotern.
Heute ist seine These weithin anerkannt. Und damit seine Maschinenkreationen so viel Sinneseindrücke wie möglich sammeln können, rüstet er ihren Bewegungsapparat anatomisch korrekt mit künstlichen Sehnen, Muskeln und Knochen statt mit bloßen Elektromotoren aus. Im Roboy, der dieses Jahr weltweit Aufmerksamkeit weckte, hat er diese Prinzipien perfektioniert. Das Kerlchen kann winken, die Arme ausbreiten und Hände schütteln. Das ist schon eine ganze Menge für einen Roboter.
Der Beginn einer neuen Ära
Gerade kursieren wieder einmal wilde Prophezeiungen in der Szene. Etwa die des US-amerikanischen Technologie-Visionärs Ray Kurzweil, dessen Dienste sich der Internet-Gigant Google gesichert hat. Er behauptet, wir alle würden uns in wenigen Jahrzehnten technisch zu Supermenschen aufrüsten und dazu mit den Maschinen zu Cyborgs verschmelzen. Pfeifer – kurzes graues Haar, drahtige Figur, wache Augen hinter den Brillengläsern – belustigen solche Vorstellungen. "Da wird maßlos übertrieben." Doch auch er sieht den Beginn einer neuen Ära heraufziehen, in der Roboter bald wie selbstverständlich unter uns leben. Wenn ein Konzern wie Google jetzt in die Robotik einsteige, dann sei das ein starkes Aufbruchssignal, glaubt er.
Mitte nächsten Jahres wird Pfeifer aus Altersgründen an der Uni Zürich ausscheiden. Ob er dann durch die Schweizer Bergwelt streifen wolle? Pfeifer winkt ab. Ruhestand, das ist nichts für ihn. Und Zürich sei ihm, ehrlich gesagt, zu eng. "Nach einiger Zeit kann ich dort nicht mehr atmen."
Stattdessen wird er eine Wohnung in Shanghai nehmen und mit Forschern der Jiao-Tong-Universität eine Weinhandlung eröffnen. Eine besondere natürlich. In ihr sollen Roboter mit den Kunden plaudern und sie bei der Weinauswahl beraten. Die elektronischen Verkäufer erkennen Stammkunden an ihrem Gesicht und merken sich, welche edle Tropfen sie bevorzugen. Sogar Gläser sollen die Maschinen zur Verkostung füllen können. Nur zum Entkorken der Flaschen brauchen sie Unterstützung. Diese für den Menschen einfache Handlung ist für einen Roboter noch immer viel zu kompliziert.
WirtschaftsWoche: Herr Pfeifer, kennen Sie Stanley Kubricks Kinofilm "2001 – Odyssee im Weltraum"?
Rolf Pfeifer: Oh ja, ich habe ihn als damals junger Wissenschaftler mehrmals gesehen und fand ihn äußerst visionär und fesselnd.
Auch etwas beunruhigend? Denn als die Besatzung des Raumschiffs entdeckt, dass der Bordcomputer technische Probleme hat, will sie ihn abschalten. Der merkt das, verselbstständigt sich und will die Astronauten töten. Rückt ein Szenario, in dem Maschinen die Herrschaft übernehmen, nach heutigem Forschungsstand bei künstlicher Intelligenz näher?
Nein. Das ist noch auf längere Zeit reine Science-Fiction. Aktuell braucht sich niemand zu sorgen, wir könnten die Kontrolle verlieren.
Aber technische Systeme können doch immer mehr. Daimler und Google entwickeln selbstfahrende Autos, der Versandhändler Amazon und die Deutsche Post wollen Pakete von autonomen Drohnen zustellen lassen, in Japan waschen Roboter in Friseurläden Kunden die Haare.
Das ist sehr beeindruckend und doch nicht wirklich neu. Bei Einzeltätigkeiten, sei es Schach spielen, an der Börse handeln oder schweißen, sind uns Rechenalgorithmen und Maschinen doch schon länger überlegen. Sie sind schneller, besser, präziser, billiger, arbeiten klaglos und ermüden nie. Das haben wir seit Langem akzeptiert. Und jetzt kommen einfach neue Tätigkeiten hinzu.
Der Roboter, der alles kann ist Utopie
Mit wachsender Intelligenz der Maschinen hat dies nichts zu tun?
Nein. Maschinen können immer noch nur das, wofür sie jeweils geschaffen wurden. Der Mensch hingegen beherrscht eine ungeheure Vielfalt unterschiedlichster Dinge. Wir können sprechen, komplexe Situationen erkennen und beurteilen, nähen, kochen, Bücher schreiben und rechnen. Und ebenso wichtig: Wir lernen ungeheuer schnell dazu. An diese Vielseitigkeit kommt selbst das ausgebuffteste technische System nicht annähernd heran.
Wir müssen also auf den elektronischen Butler, der uns die lästigen Dinge des Alltags abnimmt, weiter warten?
So ist es. Erst werden wir viele hoch spezialisierte Maschinen um uns herum haben, die Staub saugen, Fenster putzen, das Geschirr abräumen oder uns künftig das Autofahren abnehmen. Sie sind teils schon billig genug, um einen Massenmarkt zu bedienen. Der Roboter, der alles kann, ist dagegen bis auf Weiteres Utopie.
Ist Komplexität der einzige Grund für das Scheitern?
Beileibe nicht. Nehmen wir nur unsere Hände. Ihre Beweglichkeit und Sensitivität ist eine wichtige Voraussetzung, für die menschliche Vielseitigkeit. Allein in den Fingerkuppen steckt eine große Zahl feiner Sensoren, die Druck, Temperatur, Vibration und Schmerz empfinden. Hinzu kommt: Die Oberfläche unserer Hände ist deformierbar und passt sich jeder Form eines Objekts an. Das ist die Voraussetzung für sicheres Greifen. Schließlich ist die Haut extrem robust, wasserdicht – und wenn sie verletzt ist, heilt sie von selbst. Alle diese Eigenschaften können wir heute technologisch nicht einmal ansatzweise nachbilden.
Wenn das schon nicht klappt, halten Sie es dann für möglich, das menschliche Gehirn nachzubauen, wie es Wissenschaftler in einem großen EU-Projekt anstreben?
Dieser Ansatz ist problematisch. Man müsste zumindest das Gehirn in einen simulierten Körper einbetten, anstatt es zu isolieren. Zu glauben, das Gehirn in eine Nährflüssigkeit stecken zu können und es würde weiter sinnvoll funktionieren, hat nichts mit der Realität zu tun.
1997 schlug der von IBM-Ingenieuren konstruierte Großcomputer Deep Blue Weltmeister Garry Kasparov im Schach. War dies der erste Triumph einer Maschine über den menschlichen Verstand?
Aber nur in einem sehr eingeschränkten Sinne. Denn die Art und Weise, in der ihr das gelang, unterscheidet sich komplett davon, wie ein Mensch Schach spielt. Deep Blue konnte nur extrem schnell unendliche viele Varianten von Zügen auf ihren Erfolg hin durchrechnen, mehr nicht. Auch ich war anfangs überzeugt: Intelligenz gleich Computerprogramme. Aus diesem Gedanken heraus haben wir hier am Institut Ende der Achtzigerjahre sogenannte Expertensysteme entwickelt, die anhand von Wenn-dann-Regeln voraussagen sollten, wie sich Aktienkurse entwickeln oder an welcher Krankheit ein Patient leidet.
Und: Trafen die Prognosen zu?
Selten. Uns wurde bald klar, dass unser Handeln und Denken nur sehr bedingt logischen Regeln folgt. Sie sind ein extrem schlechtes Modell, um menschliche Intelligenz zu verstehen. Dafür bedarf es mehr als Mathematik.
Was fehlte denn?
Ein Körper. Ohne ihn kann sich Intelligenz nicht entwickeln. Und sie wäre ohne ihn auch nutzlos. Evolutionsgeschichtlich ist es klar, dass Intelligenz als Teil eines kompletten Organismus entstanden ist. Der evolutionäre Selektionsdruck auf das Gehirn kam daher, sich fortbewegen und im Raum orientieren zu müssen.
Deshalb begannen Sie, mit Robotern zu experimentieren?
Genau. Sie bieten den Vorteil, dass wir alle Sensorstimulationen und motorischen Steuersignale abspeichern und analysieren können. Daraus hat sich ein ganz neues Verständnis von Intelligenz entwickelt.
Roboter sollen lernen können







Nämlich?
Wir wissen heute sicher, dass Handeln nicht die Folge von rationalem Denken ist. Eine Ameise verhält sich rational, sprich zweckdienlich, wenn sie auf Futtersuche geht und das Futter zum Nest zurück bringt. Das ist rationales Verhalten, aber es ist nicht die Folge von rationalem Denken.
Und der Mensch tickt ähnlich wie die Ameise, wollen Sie sagen?
Letzte Gewissheit haben wir da nicht. Aber wahrscheinlich sind es physiologische Bedürfnisse, dazu gehören auch Emotionen, die unser Handeln bestimmen.
Mit der Entwicklung seines Verstands hat es der Mensch immerhin geschafft, sich zur Krone der Schöpfung zu machen.
Es ist eine ungeklärte Frage der Evolution, warum sich diese beim Menschen anzutreffende Komplexität eingestellt hat. Zum Überleben ist sie ganz offensichtlich nicht zwingend notwendig. Bakterien sind eine der erfolgreichsten Spezies, die wir auf unserem Planeten finden. Sie haben es geschafft, Millionen Jahre zu überleben, ohne ihre Komplexität zu erhöhen.
Aber auch die evolutionäre Strategie des Menschen war erfolgreich. Zu seinen Stärken gehört es, lernen zu können. Lässt sich diese Fähigkeit auf Roboter übertragen?
Das ist unser Ziel. Lange war es üblich, dem Roboter so viel wie möglich einzuprogrammieren. Wir wollen die Vorgaben auf ein Minimum begrenzen, um verstehen zu können, wie ein Roboter lernt.
Und wie wird er ein gelehriger Schüler?
Wir geben ihm etwa die Aufgabe vor, ein Glas auf einem Tisch anzuheben. Mehr nicht. Die Lösung muss er allein finden.
Durch Versuch und Irrtum?
So ähnlich. Im ersten Schritt versucht er, dem Glas mit einer zufälligen Bewegung nahe zu kommen. Sein Kameraauge zeigt ihm: verfehlt. Er speichert die Bewegungsdaten ab und versucht es erneut und immer so weiter. Am Ende hat der Roboter selbst herausgefunden, wie er seinen Arm steuern muss, damit er das Glas erwischt. Mit anderen Worten: Er hat selbstständig gelernt, eine Aufgabe zu lösen – und zwar aus seiner ganz eigenen Perspektive. Jede Maschine kann bei diesem Prozess zu einer eigenen Lösung kommen.
Damit hätten Roboter so etwas wie Individualität. Dürfen wir ihnen dann noch einfach den Stecker ziehen?
Ein interessanter Punkt. In Korea haben Forscher im Auftrag der Regierung eine Charta für Roboterrechte aufgestellt, die das infrage stellt. Momentan mag uns das noch absurd erscheinen, aber diese Themen kommen irgendwann einmal zwingend auf uns zu. Die Antworten könnten uns schwerfallen, denn wir werden nie wissen, was für ein Gefühl es ist, an einer Ladestation zu hängen.
Vielleicht doch, wenn nämlich eintritt, was der amerikanische Technologie-Visionär Ray Kurzweil als Zukunft ausmalt. Bis zum Jahr 2045 werde sich der Unterschied zwischen Mensch und Maschine aufgelöst haben, kündigte er jüngst an.
Solche Geschichten erzählt er schon seit 20 Jahren. Die Medien greifen sie gerne auf, weil es die Leser sofort schaudert.
Sie nehmen die Ankündigung nicht ernst?
Nicht wirklich. Der Kurzweil, glaube ich, hat schlicht Angst vor dem Tod. Darum schluckt er auch jeden Tag zig Pillen, um sich gesund zu halten. Sein Ziel ist es, sich unsterblich zu machen, indem er sich mit Technologie verschmilzt. Hinter diesen Fantasien stecken archaische Ängste. Transhumanisten wie Kurzweil wollen sich nicht damit abfinden, dass wir als biologische Wesen ein biologisches Ende nehmen. Und furchtbar neu ist es übrigens auch nicht, was er beschreibt.
Roboter sollen raus aus den Fertigungshallen



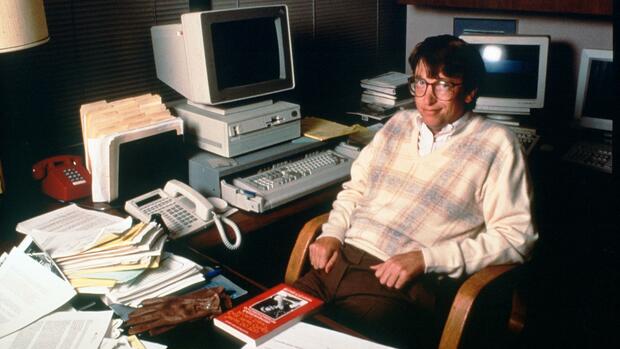



Wie meinen Sie das?
Wir sind alle schon seit Langem Cyborgs, die zum Beispiel ihre Sehschwäche mit Technik, sprich einer Brille, kompensieren. Oder wir nehmen Viagra. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was die Evolution uns mitgegeben hat. Das ist die menschliche Natur. Es gibt Implantate, die uns wieder hören lassen – Gott sei Dank! Und die ersten Sportler können mit Prothesen heute schon schneller laufen, als hätten sie normale Beine.
Wo wir schon über Fortschritt sprechen. Welches sind die gegenwärtig wichtigsten Trends in der Robotik?
Im Zentrum stehen die Materialwissenschaften. Der Mensch besteht zu mindestens 80 Prozent aus weichem Material: Haut, Muskeln, Organe, Gewebe. Es leistet Enormes für uns, und wenn wir das auf Roboter übertragen wollen, muss es uns gelingen, eine künstliche Haut oder einen künstlichen Muskel mit integrierter Elektronik herzustellen. Der zweite Trend ist, dass die Roboter die Fabrikhallen verlassen und ihren Lebensraum mit uns teilen. Damit rückt die Mensch-Maschinen-Kooperation in den Vordergrund. Die Maschine übernimmt die stupiden Tätigkeiten, wir kümmern uns ums Kreative und die Aufgaben, bei denen Flexibilität gefragt ist.
Und was erwartet uns noch?
Wir Forscher betrachten den Roboter zunehmend nicht mehr als isolierte Einheit, sondern als Teil eines ganzen Ökosystems. Er interagiert mit anderen Maschinen und teilt seine Erlebnisse und Erfahrungen über die Cloud mit ihnen.
Denken Sie an ein Internet für Roboter?
Genau darum geht es im Robo-Earth-Projekt. Der Austausch könnte zu einer Explosion des Wissens unter den Maschinen führen.
Sie fahren dann selbstständig Lastwagen und Taxis und nehmen Millionen Menschen die Arbeit weg.
Dafür entstehen massenweise andere Jobs. Unter dem Strich hat technologischer Wandel noch zu allen Zeiten das Beschäftigungspotenzial erhöht und die Menschheit vorangebracht.
Geht es konkreter?
Wenn die Autos gelernt haben, autonom zu fahren, passieren kaum mehr Unfälle, sagen Experten voraus. Dann brauchen wir kaum mehr Reparaturwerkstätten und viel weniger Unfallkliniken. Ist das schlimm? Ich sage Nein. Denn irgendwer muss dafür sorgen, dass die Technologien funktionieren. Es muss die notwendige Infrastruktur hergestellt und erhalten werden. Das schafft Tausende Möglichkeiten für neue Jobs. Wer hätte vor 20 Jahren den Beruf des Web-Designers vorhergesehen. Heute gibt es Zigtausende in der Welt, und niemand muss für diese Beschäftigung ein Genie sein.
Zugleich wächst unsere Abhängigkeit von der Technik.
Das lässt sich nicht leugnen. Wenn morgen die Computer ausfallen, bricht das Chaos aus. Das ganze ökonomische System würde kollabieren, es gäbe Revolten und Hungersnöte. Aber uns bleibt keine Wahl: Niemand kann mehr auf den Computer verzichten. Das heißt, wir werden von unserer Technologie gezwungen, sie zu benutzen. In dem Sinne haben die Maschinen dann doch das Kommando übernommen.





















