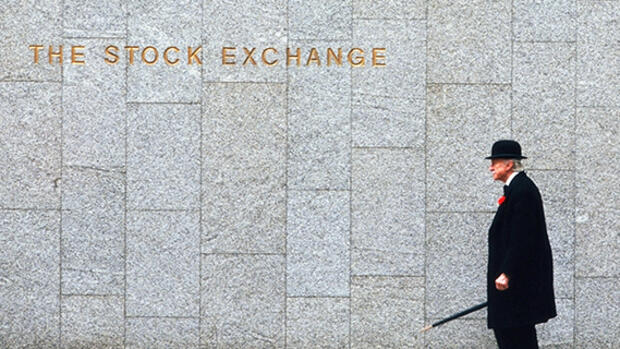
Käse aus Holland, Gin aus Großbritannien oder Schokolade aus der Schweiz finden Kunden auch in den Supermarktregalen von Edeka, Rewe und Co. Bei Finanzprodukten schaffen es viele gute und günstige Fonds nicht über die Grenze. Spesen sparen wie die Briten wird deutschen Anlegern nicht leicht gemacht. In Großbritannien wurden auf staatlichen Druck hin die jährlichen Gebühren für Fonds stark gesenkt. Für britische Anleger bleibt so deutlich mehr Gewinn übrig. Auch deutschen Anlegern bieten sich zunehmend Chancen, an diese Fonds heranzukommen.
In diese Geldanlagen stecken die Deutschen ihr Geld
Ende Juni 2015 hatten die privaten Haushalte in Deutschland nach Zahlen der Deutschen Bundesbank ein Geldvermögen von 5224 Milliarden Euro. Ein Großteil davon steckte in risikoarmen Anlagen. Anbei ein Überblick über die wichtigsten Anlageformen (Stand 2. Vierteljahr 2015, in Mrd. Euro)
2041,9 Milliarden Euro (davon Bargeld und Sichteinlagen 1172,2 Milliarden Euro, Termineinlagen 250,9 Milliarden Euro, Spareinlagen und Sparbriefe 618,9 Milliarden Euro).
149,2 Milliarden Euro
537,0 Milliarden Euro
481,3 Milliarden Euro
1978,8 Milliarden Euro
Grundsätzlich gilt: Wer Fonds kauft, wird mehrfach mit Kosten belastet.
- Ausgabeaufschlag. Beim Kauf frisst der Aufschlag einmalig drei bis fünf Prozent der Anlagesumme auf. Ihn kassiert die Bank oder der Vermittler. Immerhin: Direktbanken und -vermittler bieten Rabatte an.
- Managementgebühr. Nicht umgehen konnten Anleger bisher die jährlichen Gebühren, die die Fondsgesellschaft dem Fonds automatisch entnommen hat. Aktienfonds für Private kosten etwa 1,5 bis 2,5 Prozent pro Jahr. Legt ein Fondsanteil um sechs Prozent zu, hat der Fondsmanager tatsächlich einen Anlageertrag von mindestens 7,5 Prozent vor Kosten erzielt. Langfristig gehen diese laufenden Kosten kräftig ins Geld.
- Bestandsprovision. Von ihrer Managementgebühr gibt die Fondsgesellschaft etwa die Hälfte als Bestandsprovision an den Vertriebspartner ab, also an die Bank oder den Vermittler, der dem Kunden den Fonds verkauft hat. Der kassiert also meist nicht nur den einmaligen Ausgabeaufschlag, sondern auch einen Teil der Managementgebühr. Der jährliche Obolus ist eine Art Belohnung dafür, dass der Berater den Kunden motiviert, den Fonds zu behalten. Weil hier das Risiko besteht, dass der Berater weniger an das Wohl des Kunden als an seine Bestandsprovision denkt, sehen Anlegerschützer diese Prämien, auch „Kick-Backs“ oder „Retrozessionen“ genannt, höchst kritisch. Im europäischen Ausland sind sie zum Teil sogar verboten. Fondsgesellschaften in Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz legen neue Tranchen für Fonds auf, deren Gebühren wesentlich niedriger sind, weil die Kick-Back-Kosten jetzt entfallen.
So dürfen Banken und Wertpapiervermittler in Großbritannien laut Gesetz keine Kick-Backs mehr annehmen. Für die Anleger sollen die Kosten der Beratung und der Produkte transparenter werden. Und Verkäufer sollen nicht in Versuchung geraten, ihren Kunden vorrangig Fonds anzudrehen, für die die Institute besonders hohe Bestandsprovisionen kassieren, auch wenn die ertragsmäßig nur zweite Wahl sind.

Auf eigene Faust
Nach dem Verbot von Kick-Backs in England werden dort nur noch Anteile an neuen Fondsklassen, die sogenannten Clean-Fee-Shares, verkauft. Diese sind günstiger, weil sie von den bisherigen Kick-Backs gesäubert wurden. Weiterhin erlaubt sind bei den EU-Nachbarn Beratungshonorare, die dem Kunden direkt berechnet werden. So stellen die Banken dem Kunden etwa einen fixen Prozentsatz in Rechnung, zum Beispiel jährlich ein halbes Prozent des gesamten betreuten Vermögens oder eine Pauschalgebühr. Auch deutsche Honorarberater tun dies. Sie kassieren ein Honorar und verzichten dafür auf Ausgabeaufschläge und überweisen die Kick-Backs ihren Kunden.
Wer keine Beratung braucht, kann auf eigene Faust auf Fondsklassen umsteigen, die in England offiziell verkauft werden, in Deutschland aber noch nicht offensiv angeboten werden. Die Fondsgesellschaften wollen die Vertriebe, die Kick-Backs nur zu gerne einstreichen, nicht verärgern.





















