
Bisweilen ähnelt Wirtschaftspolitik in China einem Videospiel: Am Joystick sitzen die Planer der Kommunistischen Partei und bestimmen den Aufbau der Wirtschaftsmacht. Per Knopfdruck ziehen sie Fabriken, Häuser, Städte hoch. Sie öffnen die Geldschleusen, sobald die Weltkonjunktur lahmt – und schließen sie wieder, wenn die 1,3 Milliarden Chinesen im Treibsand der Inflation versinken.
Seit drei Dekaden betreiben die Planer das Spiel, das in Wahrheit ein Experiment in Echtzeit ist. Auch wenn den Staatsdirigenten nach dem Prinzip "Trial and Error" manchmal Fehler unterlaufen – nie hieß es bisher: Game over. Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) wächst seit Jahren zuverlässig um acht Prozent plus x.
Die Finanzkrise, die der Westen bis heute nicht verdaut hat, überstand China fast ohne Blessuren: Peking schaltete auf eine liquiditätsgetriebene Wachstumspolitik um und kompensierte Exporteinbrüche mit Staatskonsum.
Kann das auf Dauer gut gehen? Darüber rätseln westliche Ökonomen. Für Pekings Planer stellt sich die Frage anders: Wie viel Wachstum verträgt das Land, ohne dass der soziale Frieden in Gefahr gerät?
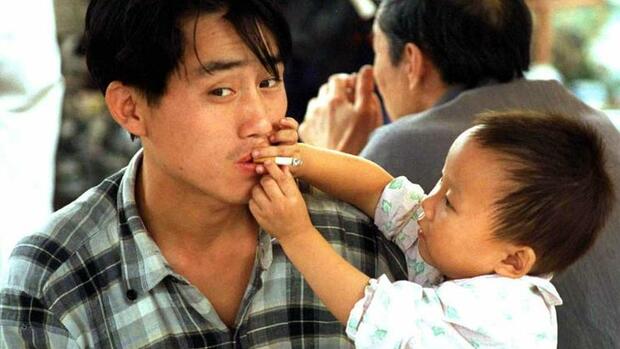

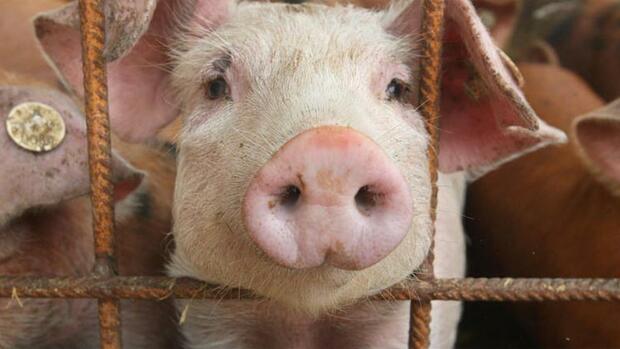




Momentan sieht es so aus, als habe das sturmerprobte Wachstumsmodell seine Grenzen erreicht. China ist längst kein Billigheimer-Land mehr, das nur Ramsch für den Westen produziert. Die Löhne steigen jedes Jahr um ein Fünftel – zusätzliches Geld, das auch ausgegeben werden will.
Immobilienmarkt ist heiß gelaufen
Da Chinas Produktionsstruktur nach wie vor auf Export ausgerichtet ist, steigen die Importe, was die Handelsbilanz im Februar ins tiefste Defizit seit zehn Jahren riss.
Das Minus ist halb so tragisch, weil Chinas Yuan weiter unter Aufwertungsdruck steht. Es zeigt aber, dass die jüngste Rechnung der Regierung nicht aufgeht: Der schrittweise Abbau der Exportabhängigkeit über den zunehmenden Binnenkonsum auf der Verbraucherseite ist allenfalls langfristig machbar.

Wer als Verbraucher heute Kapital über hat, steckt das lieber in Immobilien – ergänzt durch Kredite, die trotz restriktiver Geldpolitik und Markteingriffen immer noch deutlich unter der Inflationsrate liegen. Längst ist der Immobilienmarkt heiß gelaufen, es ist eine Blase entstanden, deren Platzen die Binnenwirtschaft aus dem Gleichgewicht bringen könnte.
Hinzu kommt, dass es die Regierung aus Angst vor einer Weltfinanzkrise mit ihrem präventiven Konjunkturpaket übertrieben hat: Die sagenhafte Summe von 586 Milliarden Dollar, die Premier Wen gleich nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers in den Geldkreislauf pumpte, floss in viel zu große Infrastrukturprojekte.




















