
Wer nach der Rede der Bundeskanzlerin auf dem jüngsten Bundesparteitag der CDU und dem anschließenden 11-minütigen Klatschkonzert nicht gleich zum Mittagessen verschwand, konnte den kurzen aber höchst bemerkenswerten Auftritt der baden-württembergischen Delegierten Christine Arlt-Palmer erleben. Sie bekundete ihr Unverständnis über die euphorische Stimmung ihrer Parteifreunde und beklagte, „dass wir immer nur verklausuliert sprechen und immer so eine Harmoniesauce über alles gießen und überhaupt nicht mehr in der Lage sind, politische Diskurse zu führen“.
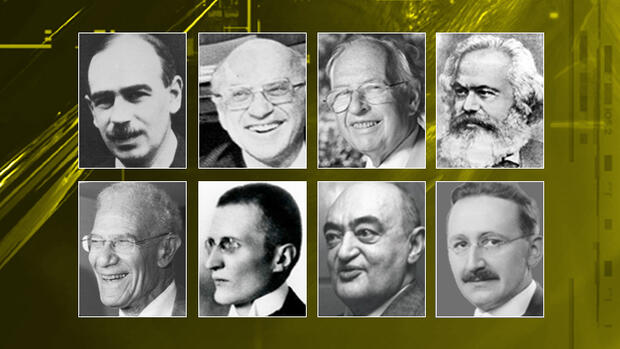

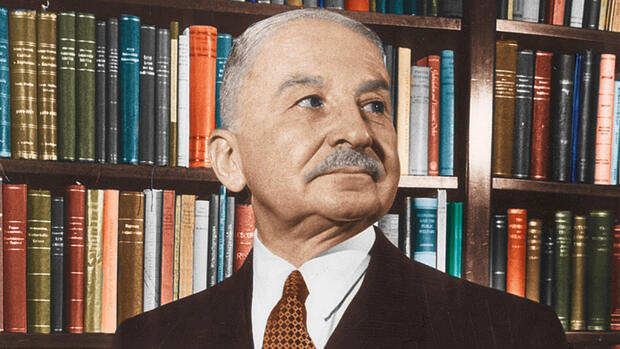
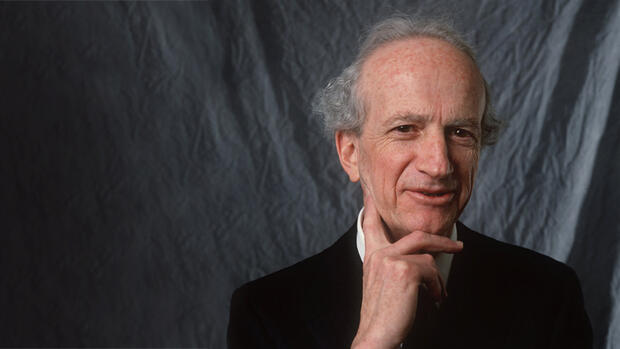



Das kann man leider nicht nur der CDU, sondern weiten Teilen, vielleicht der Mehrheit der politischen Klasse ankreiden. Hier sind wohl auch einige Ursachen für die außerparlamentarische Politisierung weiter Teile der deutschen Gesellschaft zu finden: Die Reflexion über Grundsatzfragen des Gemeinwesens – und was sonst ist denn Politik? – findet innerhalb der Parteien und Parlamente kaum statt. Dass die Öffnung Deutschlands für echte und vermeintliche Flüchtlinge im Herbst 2015 den Bundestagsabgeordneten keine Debatte wert war, ist nur der offensichtlichste Beleg dieses Versagens. Da sucht sich das politische Bedürfnis der Nicht-Abgeordneten notgedrungen andere Kanäle.
Wir werden von Politikern repräsentiert und regiert, die offenbar lieber über die (Un-)Zulässigkeit der Verwendung von Begriffen streiten – zum Beispiel NAFRI, aka „Nordafrikanischer Intensivtäter“ – als über die Wirklichkeit hinter der Sprache. Ganz offensichtlich haben sich in allen Parteien Politprofis etabliert, die zwar unfähig oder zumindest ungeübt für das Führen eines offenen politischen Diskurses sind, aber durch und durch darauf konditioniert, die „Diskurshoheit“ zu verteidigen. Also die Macht über die moralische Wertung der zentralen Begriffe, mit denen dann wiederum das eigene Handeln gerechtfertigt werden kann.
Die Einwanderungsfrage ist nur ein Beispiel für die Unfähigkeit oder den bewussten Unwillen der parteipolitischen Eliten, einen offenen Diskurs über Grundsätzliches zu führen. Eine ungeschriebene aber allseits akzeptierte Spielregel des Politbetriebes scheint festzulegen, dass man jedes große Thema (zum Beispiel Sicherheit) sofort auf betriebsinterne Machtfragen (zum Beispiel den Streit um die Abschaffung der Landesverfassungsschutzämter zu Gunsten des Bundesverfassungsschutzes) herunter zu brechen habe. Wo es um wirklich Politisches und nicht um Machtoptionen, Wahltaktik und Regierungstechnik geht, gähnt in den Parteien die reine Leere.
Das belegt nicht zuletzt die große Frage nach dem Wirtschaftswachstum. Ist es weiterhin unbedingt wünschenswert und machbar? Die Frage stellen sich immer mehr Menschen – an Universitäten und nicht nur da. Die Stimmen werden immer lauter, die Wirtschaftswachstum als Zweck der Politik in Zweifel ziehen, und die Grenzen der ökologischen und anderer Wachstumsbedingungen für erreicht halten.
Und die ökonomische Wirklichkeit gibt ihnen Recht: Wohlstandszuwächse gibt es in den Industriegesellschaften für die Mehrheit der Menschen nicht mehr; der Welthandel stagniert ebenso wie die Produktivität; selbst in den Schwellenländern gibt es nur noch geringe Zunahmen des Bruttosozialprodukts. Rekorde erzielen nur noch die Schuldenstände. Und dass die natürlichen Lebensgrundlagen durch weiteres Wachstum noch mehr zerstört werden als ohnehin schon, können nur Öko-Ignoranten wie Donald Trump oder hierzulande die Träumer vom „Grünen Wachstum“ ausblenden.






















