


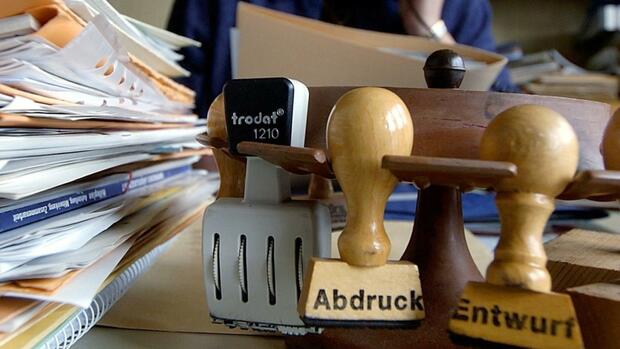
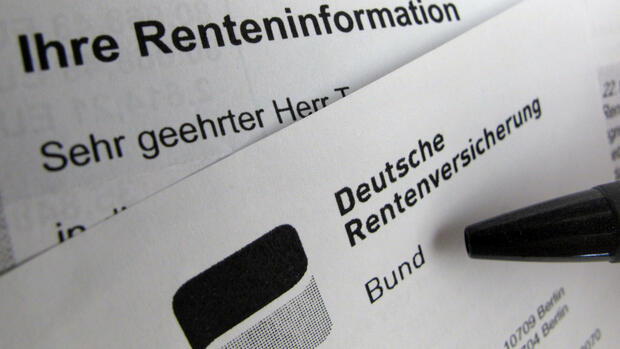


Wenn Andrea Nahles gute Argumente für ihre Politik sucht, dann stellt sie sich am liebsten Menschen vor, die sie kennt. Ihren Vater zum Beispiel. Oder ihre Nachbarin. Nahles’ Vater hat sich als Maurer auf dem Bau Rücken und Schultern ruiniert, nach mehr als vier Jahrzehnten Plackerei war er dann mit Anfang 60 „schwer angeschlagen“. Und in dem Eifeldorf, in dem die Ministerin wohnt, hat ihr eine Nachbarin vor Kurzem mitten auf der Straße Mut zugesprochen. Diese Mütterrente sei „Anerkennung für Frauen wie mich“, hat die Bekannte gesagt.
In diesen Momenten glaubt die SPD-Politikerin, dass sie alles richtig macht. „Konkrete Menschen“ und ihre Geschichten sind es, aus denen sie ihre Kraft zieht, wenn die Akten mal wieder besonders trocken sind oder die Kommentare in den Zeitungen besonders kritisch. Ihr Vater musste am Ende mit 61 Jahren in Rente gehen und dafür gehörige Abschläge hinnehmen. Gerecht fand Nahles das nie. Heute ist die Maurertochter Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Herrin über den größten Etat der Regierung, und ihr politischer Kampf für das, was sie vehement „mehr Gerechtigkeit“ nennt, hat unverkennbar eine starke biografische Note.
Man darf sich die ehemalige Generalsekretärin also als Überzeugungstäterin vorstellen. Sie wirkt in diesen Tagen entschlossen, unbeirrbar und mit sich im Reinen. Da möge die Kritik prasseln, wie sie will. Ob EU-Kommissare, SPD-Altvordere wie Gerhard Schröder oder Franz Müntefering, Wirtschaft oder Wissenschaft, sogar die Kirche – selten war die Phalanx der Mahner und Warner größer und ihre Meinung einhelliger: Das schwarz-rote Rentenpaket ist grotesk teuer, stellt die Reformanstrengungen der Vergangenheit infrage und gefährdet ohne Not ein Altersversorgungssystem, dass auch ohne die geplanten Eingriffe genügend unter Druck geraten wird. Und was tun die Kanzlerin, der Rest des Kabinetts und die – zahlenmäßig – starke Unions-Fraktion? Zucken nur mit den Schultern.
„Die Bundesregierung legt ihre Priorität auf Umverteilung“, kritisiert Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). „Das mag politisch gewünscht sein, ist jedoch ökonomisch riskant.“ Und ein SPD-Mann wie Florian Gerster, ehemals Chef der Bundesagentur für Arbeit, sagt: „Die Ignoranz, mit der die große Koalition vorgeht, macht mich sprachlos."
Die Rentenversicherung mit ihrer jährlichen Umlagemaschinerie von einer Viertelbillion Euro muss für 35 Millionen Beitragszahler ebenso funktionieren wie für mehr als 20 Millionen Ruheständler. Die Rentenreformen der vergangenen zwei Jahrzehnte schlugen deshalb stets den Weg des geteilten Leids ein. Um das System sowohl für immer mehr und immer länger lebende Rentner als auch für Einzahler gleichermaßen akzeptabel und finanzierbar zu halten, mussten alle Seiten Opfer bringen: Die Ruheständler mit geringeren Rentenzuwächsen, die Arbeitnehmer mit Beitragssteigerungen und späterem Renteneintritt – und die Steuerzahler über steigende Bundeszuschüsse an die Rentenkasse. Alle mussten ihren Teil beitragen.




















