
Die FDP ist schuld. Wieder mal. Das allein wäre für übelwollende Zeitgenossen keine Nachricht, bis auf die Tatsache vielleicht, dass das auch im Mai 1949 nicht anders war. Der politischen Legende nach war es ein Liberaler, der damals jenen Stimmen-Kompromiss vorgeschlagen hatte, der das deutsche Wahlsystem bis heute prägt - und den das Bundesverfassungsgericht heute mit seinem Urteil verworfen hat.
Der Liberale Max Becker, ein promovierter Jurist, saß vor 63 Jahren dem Wahlrechtsausschusses des Parlamentarischen Rates vor. Der Job war einer der schwierigsten seiner Zeit, denn der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee hatte zum Wahlsystem keinen konkreten Vorschlag vorgelegt. In Beckers Ausschuss hatten die Mitglieder daher lange darum gerungen, wie in Deutschland künftig gewählt werden solle. Dabei standen sich zwei Meinungen gegenüber: CDU und CSU erwärmten sich für ein relatives Mehrheitswahlrecht nach angelsächsischem Vorbild, dagegen bevorzugten die Sozialdemokraten die Verhältniswahl.
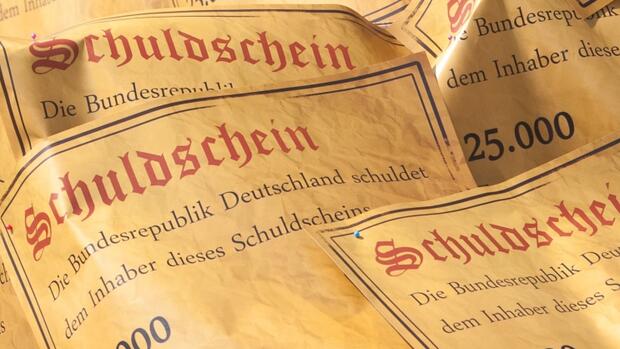






Nach komplizierten Verhandlungen verständigten sie sich auf ein Misch-System: Über die Erststimme wird ein Teil der Mandate seither direkt an jenen Wahlkreiskandidaten mit den meisten Stimmen vergeben. Über die Zweitstimme wird ein anderer Teil anhand von Parteilisten verteilt. Blieb nur das Problem, was eigentlich geschehen würde, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach ihrem Zweitstimmenanteil eigentlich zugerechnet werden müssten.
Es soll Max Becker gewesen sein, der ein Modell vorschlug, das später unter dem Namen „Überhandmandat“ bekannt wurde: Das Direktmandat steht dem gewählten Abgeordneten demnach immer zu, selbst wenn dadurch die Zahl der Sitze im Parlament steigt. Der Wahlrechtsausschuss stimmte zu – nicht ahnend, dass sich später ein ganz anderes Problem auftun würde. Durch ein Phänomen, das die Verfassungsexperten „negatives Stimmgewicht“ nennen, kann es passieren, dass eine Partei trotz Stimmenverlusten bei der Wahl Mandate gewinnt. Ein echtes Paradoxon, das die Karlsruher Richter schon 2008 für verfassungswidrig erklärten. Sie gaben der Bundesregierung drei Jahre Zeit, um das Bundeswahlgesetz zu ändern.




















