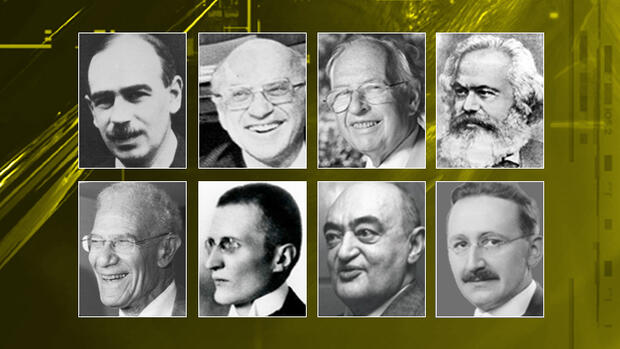

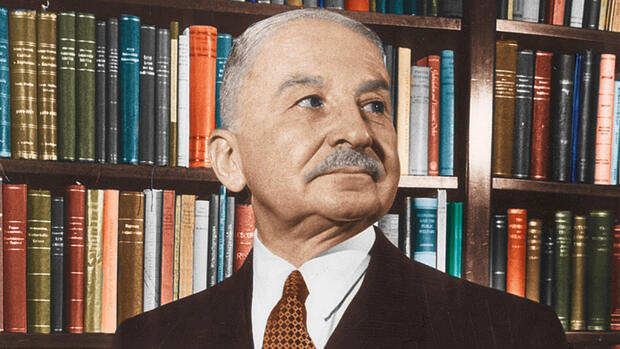
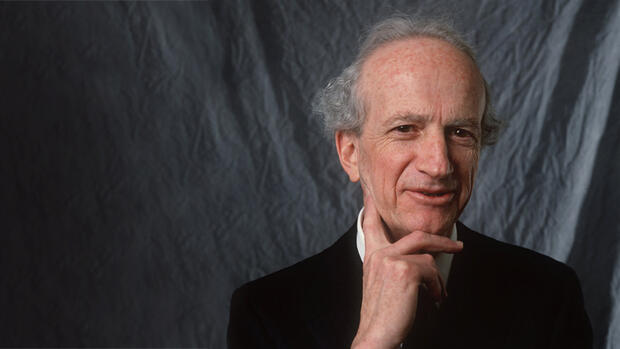



Für Adam Smith, den Urvater der Nationalökonomie, war die Sache klar. “Jeder konsumfreudige Bürger”, schrieb Smith vor mehr als 200 Jahren, “ist eine Last für das Gemeinwesen, jeder sparsame Bürger hingegen ein Gewinn”. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass die Wirtschaft durch Konsumausgaben nicht wachsen kann. Wachstum kann es nur geben, wenn der Kapitalstock steigt, wenn also mehr Geld in Maschinen, Anlagen und andere Investitionsgüter fließt. Dafür aber müssen die Bürger sparen.
Literatur von und über Adam Smith
Das 1776 erschienene Werk ist der Klassiker der ökonomischen Literatur und die erste systematische Aufarbeitung und Bündelung ökonomischen Wissens. Dass Smiths Analyse über Wachstum, Preise, Arbeitsteilung und Staatstätigkeit auch mehr als 230 Jahre später noch ihre Leser findet, liegt nicht nur an ihrer dogmengeschichtlichen Relevanz: Das Buch ist anschaulich geschrieben und kommt noch völlig ohne mathematische Formeln aus.
(dtv, 12. Auflage 2009, 855 Seiten, 19,90 Euro)
Mit dem mehrfach überarbeiteten Werk setzt Smith einen Kontrapunkt zu seiner ökonomischen These, dass Eigennutz die Triebfeder des Wohlstands ist. Smith zeichnet in seiner Moralphilosophie ein positives Menschenbild, bei dem sich die Individuen auch von Mitgefühl und Sympathie leiten lassen.
(Meiner Felix Verlag, Neuauflage 2009, 648 Seiten, 28,90 Euro)
Das Buch beschreibt die zentralen Ideen einflussreicher Ökonomen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, darunter neben Smith auch Ricardo, Malthus, Marx und Menger. Anspruchsvoll aufbereitet, trocken geschrieben. Für Leser mit ökonomischen Vorkenntnissen.
(Band 1, Beck, 2008, 359 Seiten, 14,95 Euro)
Doch was ist mit dem Staat, ist Sparen auch für ihn eine Tugend? Darüber streiten an diesem Wochenende führende Ökonomen aus aller Welt auf der Jahrestagung der American Economic Association in Philadelphia. Während auf den Straßen der Ostküstenmetropole klirrende Kälte herrscht, geht es in den Konferenzsälen heiß her. Auch sieben Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise beschäftigen deren Folgen die Ökonomenzunft.
In Europa und den USA haben die Regierungen in den vergangenen Jahren mit zum Teil drastischen Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen versucht, die Defizite in den öffentlichen Haushalten unter Kontrolle zu bringen. Dabei haben die Sparmaßnahmen das Wachstum jedoch spürbar gebremst, erklärte Olivier Blanchard, Chefökonom des Internationalen Währungsfonds (IWF).
Zwar habe die Rückführung der Defizite das Vertrauen in die Staatsfinanzen etwas verbessert. Je weniger Schulden der Staat mache, desto weniger müsse er seine Bürger in Zukunft durch Steuern für den Zinsdienst heran ziehen. Die Aussicht auf niedrigere Steuern könne die Konsumlaune der Bürger erhöhen. Doch reiche das nicht, um den Nachfrageeinbruch infolge der staatlichen Sparpolitik auszugleichen, sagte Blanchard unter Hinweis auf Berechnungen des IWF. Problematisch sei, dass die Regierungen den Rotstift vor allem bei den Investitionsausgaben angesetzt haben. Das gelte gerade für die Krisenländer der Eurozone.
Nach Ansicht von Larry Summers, Professor an der Harvard Universität, hat der Sparkurs fatale Konsequenzen. Der ehemalige Wirtschaftsberater von US-Präsident Barack Obama und Finanzminister von Bill Clinton fürchtet, dass die USA vor einer säkularen Stagnation statt vor einem kräftigen Aufschwung stehen. Summers greift damit eine These auf, die schon die Ökonomen John Maynard Keynes und Alvin Hansen vor einigen Jahrzehnten vertraten. Danach kommt das Wachstum einer Wirtschaft zum Erliegen, wenn die geplanten Ersparnisse die geplanten Investitionen übersteigen.




















