
Das Verhaltensmuster potenzieller Attentäter hat sich geändert. Die Bundessicherheitsbehörden stellen in einem Sonderbericht Wirtschaftsschutz zu den jüngsten Anschlägen fest: „Bei den angegriffenen Zielen in Paris handelt es sich um klassische „weiche Ziele“, deren Angriff in besonderem Maße geeignet ist, in der Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten. Hinsichtlich der Tatbegehung stellt der Einsatz von gleich mehreren Selbstmordattentätern ein Novum für Westeuropa dar.“ Wie können Firmen ihre Mitarbeiter und Standorte zukünftig schützen und mit vergleichbaren Krisensituationen umgehen?
Historisch richteten sich die meisten Terroranschläge gegen ausgewählte Ziele – die der Täterideologie. Insbesondere die in Westeuropa aktiven Terrorgruppen der siebziger und achtziger Jahre führten intensive Diskussionen darüber, wer in ihrem „bewaffneten Kampf“ legitimes Ziel sei – nach der Logik der Täter würden die „richtigen“ Opfer die Sympathie für die Sache steigern, bis politische Legitimität erreicht wäre. Eine Vielzahl unschuldiger Opfer wurde von vielen Gruppen als eher kontraproduktiv betrachtet.
Über den Autor
Christoph Rojahn ist Direktor Forensic bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche in Hamburg.
Die Pariser Anschläge ähneln denen auf Touristen im Nahen Osten und im asiatischen Raum, wobei scheinbar eine möglichst hohe Opferanzahl im Vordergrund stand. Auch bei den jüngsten Attentaten liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Täter ihre Ziele nach speziellen Kriterien ausgewählt hätten, so dass die Vorkommnisse nicht präzise vorhersehbar waren. Die Taten unterscheiden sich insofern grundsätzlich vom Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" im Januar 2015. Hier war die Gefährdung der Redaktion bekannt: Die französische Polizei hatte seit der Publikation der Mohammed-Karikaturen 2012 Schutzmaßnahmen eingeleitet, die allerdings nicht für einen Angriff durch mehrere schwer bewaffnete Täter ausreichend waren.
Firmen achten vor allem auf die Prävention
Islamistische Attentäter haben jedoch bislang, abgesehen von der "Charlie Hebdo"-Redaktion, keine westeuropäischen Unternehmen gezielt angegriffen. Dennoch ist anzunehmen, dass Angriffsmuster zukünftig variieren werden und Risiken schwieriger vorhersehbar sind. Das stellt Konzernsicherheitsabteilungen vor die grundsätzliche Frage, inwieweit vorhandene Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern und Standorten geeignet sind, diesen Gefahren zu begegnen.
Viele Firmen haben ihre bisherige Vorgehensweise überwiegend auf Kriminalitätsprävention und -bekämpfung ausgerichtet. Unternehmenssicherheit zielt im Sinne der Drei-Stufen-Prävention, frühestmöglicher Entdeckung und Reduzierung der negativen Auswirkungen darauf ab, Kriminellen die Tat zu erschweren. Das Entdeckungsrisiko soll so weit wie möglich erhöht (und damit abschrecken) und die Auswirkungen auf das Unternehmen begrenzt werden.

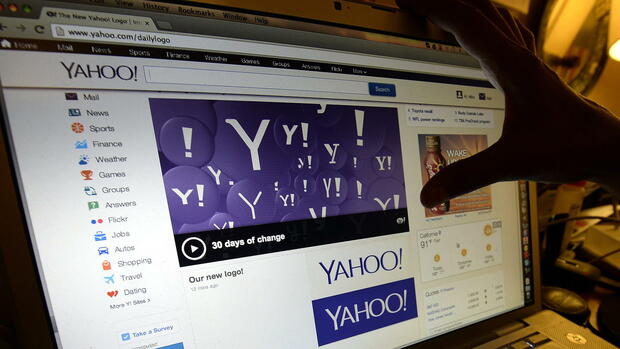
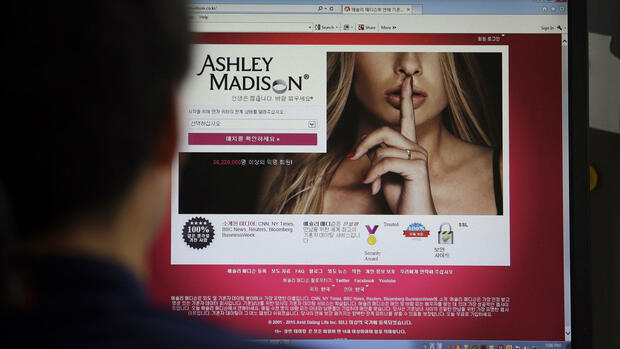




Die Erfahrung zeigt, dass sich durch Maßnahmenkombination die Gefahr für Mitarbeiter und Unternehmenswerte in vielen Fällen wirksam reduzieren lässt. Voraussetzung für einen effektiven und effizienten Schutz von Firmen und ihren Mitarbeitern ist allerdings, dass potentielle Täter rational vorgehen, indem sie lediglich bestimmte (leitende) Mitarbeiter oder finanziell attraktive Unternehmenswerte angreifen, und gleichzeitig nach der Tat entkommen wollen. Bei den großangelegten Anschlägen islamistischer Täter waren diese Einschränkungen aber anscheinend nicht gegeben. Das Verhalten der Pariser Täter deutet darauf hin, dass diese von vornherein davon ausgingen, von Sicherheitskräften gestellt zu werden.




















