


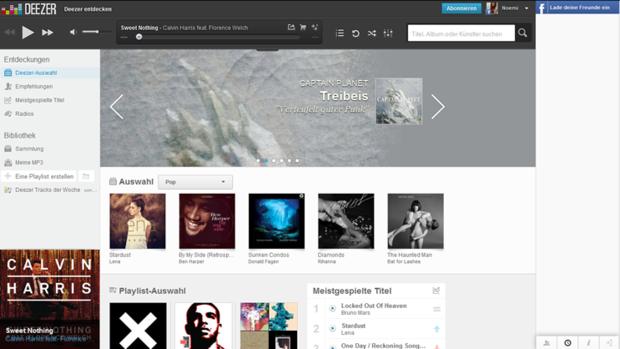



Daniel Ek, Gründer des Internet-Musikdienstes Spotify, verschwendet keine Zeit auf lange Reden. Bei seinem ersten Auftritt auf dem Branchentreff der Plattenbosse wartet der 23-Jährige geduldig, bis das Gemurmel im Saal sich legt. Seine erste Folie enthält keinen Text, nur zwei Symbole: eine durchgestrichene Piraten-Totenkopfflagge, und ein Bündel Dollar-Noten. Die zumeist älteren Herren schütteln die Köpfe; viele schauen wieder auf ihre Blackberrys statt auf die Präsentation des kahlköpfigen Schweden. Der junge Mann dort oben auf dem Panel verspricht nicht weniger, als die Produktpiraterie zu besiegen und die Musikbranche wieder auf Wachstumskurs zu bringen. In den Ohren vieler klingt das wie blanker Hohn – ausgerechnet ein Internet-Start-up erdreistet sich dazu. Das Internet ist für sie der Feind. Früher und tiefer als andere Branchen pflügt es gerade die Musikbranche um.
Das war 2006, und der Trend hat sich noch sechs Jahre fortgesetzt. Allein durch Netz-Piraterie ging der Musikbranche von 1999 bis 2012 fast die Hälfte ihres globalen Jahresumsatzes flöten. Das Problem Internet ist aber zugleich die Lösung: Der von Ek gegründete Internet-Musikdienst Spotify hat heute 41 Millionen Kunden, zehn Millionen davon zahlen regelmäßig für Musik im Internet.
Seine alte Vision vom Tod der Piraten und neuen Einnahmequellen wird wahr: 2013 stiegen die Umsätze der Musikindustrie wieder, nach 15 Jahren stetigen Rückgangs; die beiden ersten Quartale 2014 geben Anlass zu noch mehr Optimismus, bis 2018 soll der Umsatz der Branche in Deutschland laut den Konsumforschern von GfK um gut zehn Prozent zulegen. Zwar fallen die CD-Verkäufe weltweit weiter rapide. Doch eine neue digitale Vermarktungsform wächst rasant, je nach Land mit Raten von bis zu 90 Prozent pro Jahr: Musik-Streaming.
Dabei greifen die Kunden gegen eine monatliche Pauschale (Flatrate-Abo) von rund zehn Euro über das Netz auf den gesamten Katalog fast aller Musikverlage zu. Bis zu 32 Millionen Titel aus allen Genres stehen ihnen für relativ kleines Geld zur Verfügung – wann sie wollen, wo sie wollen, so oft sie wollen, vom Handy aus, vom PC, über die Stereoanlage. „Eine radikal kundenfreundliche Lösung, die anfangs in der Branche umstritten war,“ sei das, sagt Philip Ginthör, Chef von Sony Music Mitteleuropa.

Doch wahrscheinlich ist Streaming die letzte Chance, die über Jahre eingeschliffene Gratiskultur im Netz zu besiegen. Mit wegweisender Wirkung für andere Medienbranchen. „Die Musikindustrie hat nach 15 Jahren des Niedergangs endlich Geschäftsmodelle gefunden, die ihr das Überleben in der rein digitalen Zukunft ermöglichen“, sagt Adam Bird, Director bei McKinsey und weltweit zuständig für Medien und Entertainment. Immer mehr Menschen bezahlen wieder für Musik, weltweit sind es schon über 30 Millionen, Tendenz steigend (siehe Grafik auf Seite 2) – obwohl es weiter illegale, kostenlose Angebote gibt.
Das Schlimmste kommt noch
TV-Sendern, Filmstudios und vor allem Verlagen, meint Bird, stehe der härteste Teil des Umbruchs noch bevor. Meilenweit seien die großen Player noch von einer gemeinsamen Netz-Strategie entfernt, von einem Schulterschluss über Branchengrenzen hinweg ganz zu schweigen. Doch die zweite Internet-Revolution betreffe „alle, die mit geistigem Eigentum handeln“, sagt Dieter Gorny, Chef des Bundesverbands Musikindustrie und Gründer des TV-Senders Viva, „auch TV-Sender und Verlage werden in 15 Jahren nicht wiederzuerkennen sein.“ Immer mehr Konsumenten wandern ab vom traditionellen TV zu den neuen Angeboten wie Netflix oder Hulu, lesen auf dem iPad statt auf Papier, hören Napster, Simfy oder Spotify statt Radio.
Die großen Werbebudgets werden den Nutzern folgen und so die Umsätze der Etablierten weiter gefährden. Seit Neuestem drängen nun auch die Internet-Giganten Apple, Google und Amazon in das Geschäft. Sie haben das Potenzial von Streaming erkannt – und tiefe Taschen. Für Anleger bietet das Thema enorme Chancen. Sie tun gut daran, nicht zu spät auf den Trend zu springen. Im ersten digitalen Umbruch von 1988 bis 2000 wurden die Gewinne zu Anfang gemacht, nicht erst kurz vor der Jahrtausendwende, als die Investmentbranche den Trend in Fonds und Zertifikate gegossen und ihre Promotion-Maschinen angeworfen hatte.
Der große Testfall
Gibt es ein Überleben in der Internet-Welt für ein Geschäft, das auf dem Verkauf geistigen Eigentums beruht? An dieser Frage scheiden sich im Moment die Geister. US-Starökonom Jeremy Rifkin sieht eine „neue Kultur des Teilens“ im Netz, die tradierte Geschäftsmodelle der Musik-, Film-, Buch- und Zeitungsindustrie „ausradieren“ werde. Dagegen glaubt Bird von McKinsey: „Mehr Menschen als je zuvor konsumieren dank Internet Musik, Film und Texte; das sind goldene Zeiten für Inhalteanbieter – wenn sie die richtigen Formate finden.“
Die Musikindustrie jedenfalls gilt als „der große Testfall, auf den die Manager der anderen Branchen mit einer Mischung aus Angst und Faszination schauen“, sagt Christoph Zeh, Analyst für Medien beim Marktforschungsinstitut GfK in Nürnberg. Sie wurde gut zehn Jahre früher als andere Medien von der Gratiskultur im Netz erfasst: „Musikdateien sind – verglichen etwa mit Film – relativ klein; man konnte sie schon Ende der Neunziger leicht illegal aus dem Netz ziehen, als Bandweite und Geschwindigkeit noch echte Hindernisse waren“, sagt James McQuivey, Analyst beim IT-Trendforscher Forrester und Autor des US-Bestsellers „Digital Disruption“.
Das Geschäft mit dem Musik-Streaming
Nachdem MP3-Dateien CDs und Platten ersetzten, bringt das Streaming eine vielleicht noch größere Veränderung für die Musikbranche. Denn die Nutzer zahlen nicht mehr für den Besitz von Musik, sondern deren Nutzung. Für eine Monatsgebühr erhalten sie Zugriff auf Musikkataloge mit Millionen Titeln. Zudem gibt es auch kostenlose Angebote, die über Werbung Geld einnehmen.
Laut dem Bundesverband der Musikindustrie haben die Streamingdienste stark an Bedeutung gewonnen. Derzeit (Stand Sommer 2014) haben sie einen Anteil von fünf Prozent am Musikmarkt. Nach Schätzungen sollen sie 2018 schon 35 Prozent des Marktes ausmachen.
Künstler kritisieren immer wieder die geringe Vergütung – pro gehörtem Stück erhalten sie Bruchteile eines Cents. Die Einnahmen sind bislang deutlich geringer als über die Verkaufsbeteiligungen. Trotzdem schreiben auch Streamingdienste wie Spotify Verluste. Wie sich die Kalkulationen von Streaminganbietern, Plattenfirmen und Musikern künftig ausbalancieren, ist eine der entscheidenden Fragen.
Die Folge: Weltweit fielen die Umsätze mit aufgezeichneter Musik (ohne Konzertgeschäft) von 26 Milliarden 1999 auf 15 Milliarden Dollar 2013; die Zahl der weltweit agierenden, alle Genres abdeckenden Musikverlage (Major Labels) halbierte sich von sechs auf drei. Nun ruhen die Hoffnungen auf den digitalen Streaming-Abos, deren Umsatz und Nutzerzahlen gerade rapide wachsen. 2013 stieg der Streaming-Umsatz weltweit um 51 Prozent, auf zuletzt 1,11 Milliarden Dollar, sagt Christina Boettner, leitende Marktforscherin des globalen Dachverbandes der Phonoindustrie IFPI. Die Zahl der zahlenden Kunden wuchs um 40 Prozent auf 28 Millionen.
Nutznießer sind nicht zuletzt die Labels selbst, denn die Streaming-Dienste geben 55 bis 70 Prozent ihres Umsatzes an die Plattenfirmen weiter. Allein Marktführer Spotify hat seit 2008 mehr als eine Milliarde Dollar Lizenzgebühren ausgeschüttet. Bei Sony stieg der Streaming-Umsatz 2013 um 130 Prozent. Warner Music meldete vergangene Woche 26 Prozent plus beim Digital-Umsatz auf 324 Millionen Dollar im letzten Quartal. 41 Prozent des Umsatzes sind bei Warner inzwischen rein digital (auch eine CD ist streng genommen digital, gemeint sind nicht-physische Formen wie Streaming und MP3-Downloads). „In einigen Ländern mit hoher Smartphone-Durchdringung, wie etwa in Schweden, macht Streaming schon 60 bis 70 Prozent der Umsätze aus“, sagt Marktforscherin Boettner.
Zweifrontenkrieg
Will die Medienindustrie im Kampf gegen die Gratiskultur im Netz obsiegen, muss sie zwei entscheidende Nutzergruppen für ihre Bezahlangebote gewinnen, sagt McQuivey von Forrester: „ Die junge Konsumentenschicht, die mit kostenlosen Inhalten im Netz aufgewachsen ist, und die Bevölkerung der Schwellenländer, die mit der westlichen Idee des Urheberrechts nicht viel anfangen kann.“
Zu den Leuten, die die Branche noch überzeugen muss, gehört Tim Borchers*, 17, aus Köln. Er surft im Netz, seit er acht ist, und zieht alles heraus, was er haben will: Songs, ganze Alben, Filme. Seine Sammlung umfasst mehrere Terabyte. Bezahlt davon hat er nichts, er kenne es nicht anders, sagt Tim. Ob das legal ist, sei für ihn kein Kriterium. „Ich hätte sowieso kein Geld, das zu kaufen, also entgeht denen auch kein Umsatz“, gibt er sich geschäftsmännisch. Tim „shared“ auch, was er aus dem Netz zieht: „Wenn ich was cool finde, sollen das auch meine Freunde sehen oder hören“, sagt er, „ich gebe denen ’nen Stick mit MP3s oder schicke den Link zum Download per Mail.“ Und er kennt schon einen Kniff, der Streaming unterminiert: Sein Vater habe ein Premium-Abo, sagt er. Die so zugänglichen Lieder schneidet Tim mittels einer Software mit, die ganz legal erhältlich ist: Die kopiert alles, was über die Soundkarte seines PCs läuft: Spotify, YouTube, Internet-Radio.
Serviceangebot besiegt Gratiskultur
Will Page ist von Haus aus Ökonom; er arbeitete für Banken, verfasste vor 20 Jahren Studien über die Integration der DDR in den Kapitalismus. Jetzt ist er Chefökonom und Leiter Research bei Spotify und beschäftigt sich mit Leuten wie Borchers, „allerdings nicht, wie in unserer Branche 20 Jahre lang üblich, mit Kopierschutztechnik und Anwälten“, sagt der Schotte. Page erforscht, ob und wie sich an eine jahrelange Gratiskultur gewöhnte Konsumenten mit „positiven Anreizen“ für legale (und natürlich kostenpflichtige) Angebote zurückgewinnen lassen; seine Forschungen lassen aufhorchen, nicht nur in der Musikbranche. In den USA spricht er jetzt oft vor TV- und Filmmanagern, etwa bei Time Warner, beim Kabelriesen Viacom oder bei Disney.
Page macht seine Fallstudien dort, wo es besonders weh tut: in Holland, Russland oder Italien – Länder, in denen wegen eines laxen Urheberrechts das Musikgeschäft bis vor Kurzem so gut wie tot war. Ein neuer Nummer-eins-Hit etwa wurde in den Niederlanden pro legalen Download über 100 Mal illegal aus dem Netz gezogen; in Umfragen gaben 2005 rund 90 Prozent der Holländer mit Internet-Anschluss an, gratis Musik aus dem Netz zu ziehen. Doch das ändert sich gerade:
„Bereits der Start von Apples iTunes 2004 hat die Raubkopier-Rate erheblich gesenkt“, meint Page, „und seit fast jeder Holländer ein Smartphone und eine Handyflatrate hat, ist die Piraterie dort so gut wie erledigt. Heute macht nur noch ein harter Kern von rund zehn Prozent der Internet-Nutzer Raubkopien, und das aus Prinzip.“
Auffällig sei, „dass Streaming im Moment vor allem junge Musikfans unter 25 Jahren gewinnt“, beobachtet auch Holger Christoph, Vice President Digital Sales bei Universal Music in Berlin, „etwa die Hälfte der Streamingnutzer war zuvor Nichtkäufer, die bislang gar kein Geld für Musik ausgegeben haben.“

Sind die Teenager weltweit auf einmal zu braven Verfechtern des geistigen Eigentums mutiert? „Wohl kaum“, sagt Philip Ginthör, Chef von Sony Music im deutschsprachigen Raum. Der gelernte Anwalt sagt: „Mit Abmahnungen und dem Schließen von Piraterie-Web-Seiten würden wir die jungen Leute nie zurückgewinnen.“ Ginthör setzt stattdessen auf „Convenience“: Der Kunde soll es so bequem wie nur möglich haben; mit Musik auf allen Kanälen, auf dem Handy, vom PC, aus der Hi-Fi-Anlage. Dann werde er schon zahlen.
McQuivey sieht hier die einzige Lösung: „Sobald das professionelle Angebot für die Leute bequemer, schneller und einfacher ist als das illegale oder kostenlose, bezahlt ein hoher Anteil der Nutzer auch wieder dafür“, sagt er. Laut Umfragen sind in den meisten Ländern 45 bis 65 Prozent der Bevölkerung prinzipiell bereit, für Musik Geld auszugeben – solange sie die bequem und ohne lästige Einschränkungen der Auswahl bekommen.
Zum ersten Mal legal gehört
Die Inhalte-Schaffenden selbst sind noch gespalten; viele Künstler üben harsche Kritik an den niedrigen Tantiemen, die das Streamen im Vergleich zu CD und Dateidownload abwirft – noch. Einige, wie die Alt-Rocker AC/DC, untersagen ihren Rechteverwertern gar das Einspeisen ihrer Werke in die Internet-Dienste. Andere, wie der Belgier Jonathan Vandenbroeck, besser bekannt als Milow, sehen die Chancen:
„Streaming ermöglicht vielen Menschen überhaupt zum ersten Mal, Musik legal zu konsumieren“, sagt Milow. Viele Menschen in Schwellenländern hätten keine teuren CD-Player, aber Smartphone und Internet-Flat. Die aktuelle Debatte findet er kurzsichtig: „Ich denke, dass Streaming künftig mehr Leute erreicht, die noch nie oder seit langer Zeit nicht mehr für Musik bezahlt haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir sogar höhere und vor allem regelmäßigere Lizenzeinnahmen erhalten werden.“
Das wäre wichtig; denn ohne Geld würde früher oder später auch der Nachschub an interessanten Inhalten austrocknen. Aus Sicht der Konsumenten ist die Sache klar: „Die Musikindustrie war noch nie so kundenfreundlich“, sagt Bird von McKinsey. Früher jubelte sie ihren Kunden alte Songs aus dem Archiv oder mies digital neu abgemischte Klassiker für teures Geld unter. Bird: „Heute kann jeder hören, was er will, so oft er will.“ Folge: Nicht nur Fans mit riesigen Plattensammlungen, die ohnehin viel Geld für ihre Leidenschaft ausgeben, sondern auch Menschen wie Albert Erdmann, 55, lassen sich ködern.
Netzanbieter schaffen neue Musikkunden
"Mir war es immer zu anstrengend, neue Musik zu suchen, ich hörte halt, was im Radio lief“, sagt der Ingenieur. „Die Folge war, dass ich vor 20 Jahren ganz aufhörte, mir Musik zu kaufen, ich dachte: Heute wird eh nur noch Schrott gemacht, aber das ist falsch.“ Lässig sitzt Erdmann in der Hollywoodschaukel seines Obersendlinger Gartens und führt auf dem iPad vor: Ein Algorithmus empfiehlt ihm laufend neue Künstler; er funktioniert ähnlich wie der für Bücher bei Amazon: Du hast X und Y gehört, probier’ mal Z. „Anfangs habe ich den ausgelacht“, sagt Erdmann, „ich programmiere selbst und weiß, wie das Zeug arbeitet; aber er wird immer besser und genauer, je mehr man ihn nutzt.“ Gefällt ihm ein Lied, speichert Erdmann es ab; er „besitzt“ es dann zwar nicht physisch, es liegt noch immer auf den Servern des Anbieters, irgendwo in der Datenwolke, der Cloud. Doch Erdmann kann es für zehn Euro im Monat nun so oft hören, wie er will, und alle 24 Millionen restlichen Lieder im Bestand ebenso. „Auch offline“, sagt er, „unterwegs auf dem Handy oder so, dann verbrauche ich dabei nicht die teuren Datenkontingente meines Handyvertrags.“
„Wir wollen potenziell jeden Menschen auf der Welt erreichen, der ein Smartphone besitzt“, sagt Page von Spotify, „genauer: 80 Prozent davon, denn so hoch ist in fast jedem Kulturkreis der Anteil der Menschen, die regelmäßig Musik konsumieren.“ Nur zahlte bislang nur eine Minderheit dafür. „Der Musikkonsum selbst ging nie zurück“, sagt Zeh von der GfK, „aber die Monetarisierung durch Künstler und Rechteverwerter litt unter Pirate Bay oder Napster.“
McQuivey von Forrester ist noch skeptisch, was das Potenzial der Kreativwirtschaft in den Schwellenländern betrifft: „In fast allen westlichen Ländern und in Japan geben die Menschen im Schnitt 65 Dollar pro Jahr für Musik aus; das Geld brauchen die meisten Bewohner Chinas, Indiens oder Brasiliens für wichtigere Dinge; außerdem wird in Teilen Asiens der Begriff ,Copyright‘ als ,Recht zu kopieren‘ verstanden.“
Doch es gibt andere Wege, Länder wie China zu erobern: „Als hilfreich haben sich Partnerschaften mit Telekomanbietern erwiesen“, sagt Verbandsmanagerin Boettner, „die Kunden bekommen Musik günstig als Teil ihres Datenpakets, Künstler und Labels bekommen Lizenzeinnahmen, der Telekomanbieter kann sich mit Inhalten von Konkurrenten abgrenzen.“
In Ländern wie Mexiko, Brasilien oder Thailand hat die Musikindustrie bereits zahlreiche Deals mit Handynetzbetreibern geschlossen. Labels wie Universal (4,9 Milliarden Euro Jahresumsatz, gehört zum Vivendi-Konzern) haben mit chinesischen Künstlern erste Verträge unterzeichnet; Verwertungsverträge mit lokalen Internet- und Handynetzbetreibern wie China Mobile oder Baidu sind gemacht.
„Auch chinesische Politiker erkennen, dass mit medialen Inhalten Umsätze und damit Steuereinnahmen winken, ihre Einstellung zum Urheberrecht verändert sich gerade“, sagt Gorny.
Schnell Claims abstecken
Auch Risikokapitalisten und Finanzinvestoren gehen offensichtlich davon aus, dass hier Geld zu holen ist: Etliche haben sich an Streaming-Diensten beteiligt. Zwar ist noch kaum einer der Musik-Streamer profitabel, aber „es geht den meisten Investoren zunächst nicht um das Erreichen der Gewinnschwelle“, sagt André Burchart vom Risikokapitalgeber Capnamic in Köln. Im Moment herrsche „Landgrabbing“: Jeder Anbieter versucht, so viele Kunden wie möglich zu gewinnen. „Das macht auch Sinn“, sagt Burchart, „denn das Internet lässt erfahrungsgemäß pro Geschäftsidee nur einen richtig groß werden.“
Die Sieger des ersten Digitalbooms haben es vorgemacht. Ob bei Suchmaschinen (Google), E-Commerce (Amazon), Online-Auktionen (Ebay) oder sozialen Netzen (Facebook): Die einst hoffnungsvollen Zweiten wie Ricardo.de, StudiVZ, Alltheweb, MySpace blieben auf der Strecke. „Zwar wird im Musik- und TV-Streaming mehr als einer übrig bleiben; aber derjenige, der als Erster sein Geschäft global etabliert, hat einen entscheidenden Vorteil“, meint Peter Dreide, Gründer des auf IT spezialisierten Fondsanbieters TBF.
Börsengänge wahrscheinlich
Derzeit ist Spotify in der Poleposition. Die Schweden haben mit ihren zehn Millionen zahlenden Kunden etwa doppelt so viele wie die Nummer zwei, Deezer. Die kostenfreie Version, mit der man keine Musik offline auf dem Handy hören kann und Werbung über sich ergehen lassen muss, nutzen weitere 31 Millionen registrierte Kunden. Spotify, das bisher keine Umsatz- und Gewinnzahlen veröffentlicht, hat laut einem beteiligten Finanzinvestor 2013 seinen Umsatz aus Abos und Werbung grob auf eine Milliarde Euro verdoppelt, aber noch Verluste „in erheblichem Umfang“ geschrieben. 2012 fielen bei 435 Millionen Euro Umsatz 59 Millionen Euro Verlust an. „Der Fokus liegt auf globaler Expansion, noch nicht auf Profitabilität“, sagt der Insider. Spotify will seinen Service in diesem Jahr in 18 weiteren Ländern starten, darunter in Japan, nach den USA zweitgrößter Musikmarkt; derzeit sind es 56. Die drei Majorlabels Warner, Sony und Universal haben sich an Spotify beteiligt, auch Goldman Sachs, Fidelity und Coca-Cola sowie Multimilliardär Li Ka-Shing.
Die Streaming-Anbieter im Internet
Typ: Radio-Streaming
Gestartet: 2008
Sitz: Berlin
Musikangebot: kein lineares Streaming
Besonderes: Auswahl von Stationen für Musikgattungen und Stimmungen, kostenloses Angebot mit Werbung und Abo-Modell
Typ:On-Demand-Streaming
Gestartet: 2007
Sitz: Paris
Musikangebot: 35 Millionen Titel
Typ: Radio-Streaming
Gestartet: 2002
Sitz: London
Musikangebot: kein lineares Streaming
Besonderes: Spielt nach Angabe von Lieblingsgruppen Musik von ähnlicher Richtung
Typ: Radio-Streaming
Gestartet: 2000
Sitz: Oakland, Kalifornien
Musikangebot: Spielt nach Vorgaben der Nutzer Musik in ähnlicher Richtung, in Deutschland nicht verfügbar
Typ: On-Demand-Streaming
Gestartet: 2005
Sitz: Berkeley, Kalifornien
Musikangebot: 16 Millionen Titel. In Deutschland nicht verfügbar
Typ: On-Demand-Streaming
Gestartet: 1999 als Tauschplattform, seit 2005 als kommerzieller On-Demand-Service
Sitz: Los Angeles
Musikangebot: 25 Millionen Titel
Typ: On-Demand-Streaming
Gestartet: 2011
Sitz: London
Musikangebot: mehr als 22 Millionen Titel
Typ: On-Demand-Streaming
Gestartet: 2010
Sitz: San Francisco
Musikangebot: mehr als 30 Millionen Titel
Typ: On-Demand-Streaming
Gestartet: 2009
Sitz: Köln
Musikangebot: mehr als 25 Millionen Titel
Typ: On-Demand-Streaming
Gestartet: 2008
Sitz: Stockholm
Musikangebot: über 20 Millionen Titel
Es gibt überraschende Profiteure des Booms. Zu ihnen gehört Peter Grundig. Seine Firma Greatech betreibt der 58-Jährige in einem unscheinbaren Wohnhaus in Mülheim/ Ruhr; dort baut er mit einer Handvoll Mitarbeitern Funksysteme zusammen. „Alles made in Germany“, sagt Grundig, der mit der fränkischen Elektronik-Dynastie weitläufig verwandt ist, „sogar die Gehäuse.“ Die kleinen schwarzen Kästchen – so groß wie eine Zigarettenschachtel – kommen an die Stereoanlage oder an aktive Lautsprecherboxen, ein kleiner Sender in den USB-Anschluss von Laptop, PC oder iPad – fertig ist die drahtlose Verbindung von der neuen Welt des Web-Streamings auf die alte der Hi-Fi-Anlage. Grundig rüstet Profis wie DJs aus. Auf Privatkunden, die mit den Audiofly genannten Kästchen ihr Spotify oder Deezer-Abo in guter Qualität auf die Stereoanlage übertragen wollen, war er gar nicht eingestellt, derzeit kann er die Nachfrage kaum befriedigen. „Normalerweise verkaufe ich knapp 1000 Stück im Jahr; jetzt kommen fast jeden Tag Anfragen für ein paar Dutzend rein.“ Sein Sohn sei gerade in Saudi-Arabien, sagt er, „für die Saudis machen wir die Gehäuse vielleicht golden statt schwarz, aber der Klang überzeugt auch die“.
Übernahmekandidaten
Fast jede Woche wird irgendwo auf der Welt ein neuer Musik- oder Film-Streamer gegründet. „Klar ist, dass nicht alle überleben werden“, sagt Burchart von Capnamic, der für seine Kunden – Vermögensverwaltungen reicher Familien, Verlage und Stiftungen – auch in Streaming-Dienste investiert, darunter in den Spotify-Konkurrenten Simfy und Video-Streamer Moving Image 24. Burchart erwartet „Übernahmen und Börsengänge“ in dem noch jungen Geschäft. US-Musik-Marktführer Pandora ging im Januar 2011 an die Börse, ist dort knapp vier Milliarden Dollar wert. In den vergangenen Tagen gab es Übernahmegerüchte: Ein großes Internet-Unternehmen wie Yahoo oder Google interessiere sich für den Streamer, heißt es.
Auch die Berliner Soundcloud sowie Deezer aus Paris gelten als heiße Kandidaten für einen Aufkauf oder einen Börsengang. Spotify wird von Investmentbankern auf bis zu elf Milliarden Dollar Börsenwert geschätzt. Google soll Ende 2013 versucht haben, die Schweden zu kaufen, scheiterte aber. Twitter soll einen Kauf von Soundcloud erwogen haben.
Spotify hat seit 2005 in sieben Finanzierungsrunden insgesamt 538 Millionen Dollar Investorengelder eingesammelt. „Das schreit alles nach Börsengang“, sagt Viva-Gründer Gorny. Oder nach einem großen Verkauf: Womöglich kauft Facebook die Schweden. Schon jetzt arbeiten die beiden Unternehmen intensiv zusammen: Kunden können sich über Facebook bei Spotify einloggen und dann die Playlisten und Aktivitäten anderer Spotify-Nutzer mit Facebook-Account nachverfolgen. „Für Facebook wäre Musik-Streaming ein interessanter Inhalt“, sagt ein Investor.
Wer verdient das große Geld?
Noch sind reinrassige Musik-Streaming-Dienste an der Börse selten: Anleger haben die Wahl zwischen Pandora und Sirius XM. Oder sie können via RealNetworks in Rhapsody investieren, das in Europa und Asien Napster heißt, nicht zu verwechseln mit der ersten Napster, deren Piraterie-Seite die Gerichte 2001 schlossen. Real Networks gehören nach der Ausgliederung von Napster noch knapp 50 Prozent der Rhapsody-Anteile.
Im Bild-Streaming ist Netflix aus den USA Marktführer, bietet Filme, TV-Shows und zahlreiche populäre Serien wie „House of Cards“ oder „Breaking Bad“. Laut Umfrage des Marktforschers Harris ist der TV- und Film-Streamer bei den 18- bis 36-Jährigen in den USA schon genauso weit verbreitet wie Kabelfernsehen, hat das Satelliten-TV überholt. In wenigen Wochen geht der Streaming-Dienst in Deutschland an den Start. Die größten Konkurrenten sind Hulu, ein Joint Venture von Kabelanbieter Comcast, 21st Century Fox und Disney, sowie Amazons „Prime TV“. Netflix meldet eindrucksvolle Wachstumszahlen, wird an der Börse aber sportlich bewertet: Für 4,4 Milliarden Dollar Umsatz (2013) bezahlen Anleger knapp 27 Milliarden Dollar ; das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 115, gemessen an den Schätzungen für das laufende Jahr.
Wahrscheinlich ist es langfristig gar nicht mal die beste Idee, auf die Pure-Plays zu setzen. „Das Geschäftsmodell der reinrassigen Streamer funktioniert zwar, sobald sich mehr Leute dafür gewinnen lassen, und da sieht es sehr gut aus“, sagt Investor Dreide, „aber die Frage ist, wer am Ende das große Geld verdienen wird.“ Auffällig drängen in den letzten Wochen die Web-Giganten Apple, Google und Amazon in das Streaming-Geschäft. Apple kaufte für drei Milliarden Dollar den kleinen Anbieter Beats, besser bekannt durch seine Kopfhörer. Google übernahm den Musik-Streamer Songza und hat mit YouTube 90 Prozent Marktanteil bei Internet-Videos, die auf dem PC, Tablet oder Handy geschaut werden. Amazon bietet seit Kurzem Musik-Streaming für seine „Prime“-Kunden; Yahoo macht sich einen Namen beim Streamen exklusiver Live-Konzerte.




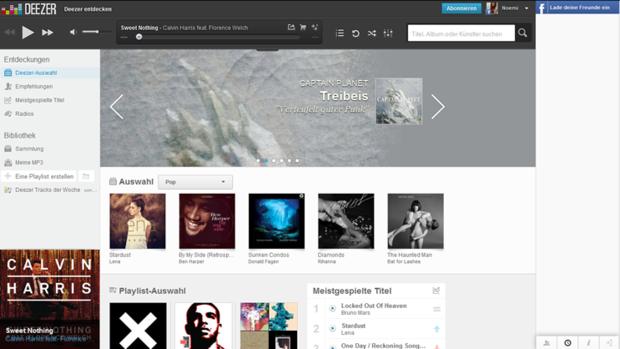


„Apple will die Kunden für seine Hardware, wie iPad und iPhone, über Inhalte an sich binden“, sagt Analyst McQuivey. Dazu gehören Musik, TV, Film. Wer etwa sein iPhone durch ein Konkurrenzmodell ersetzt, kann weder seine Musiksammlung, noch seine Filme und Apps weiter nutzen.
Zusätzlich wollen die Web-Giganten über Musik- und TV-Kunden an die großen Werbebudgets: 2014 werden global laut Marktforscher Wilkofsky Gruen rund 509 Milliarden US-Dollar für Werbung ausgegeben, der größte Teil davon für TV-Clips (204 Milliarden Dollar); doch rein digitale Werbeformate haben Radio und Print schon überholt, „sie werden in den kommenden Jahren am schnellsten wachsen“, sagt McKinsey-Director Bird.
„Schon in zehn Jahren wird der Großteil der Werbebudgets an Internet-Plattformen wie YouTube, Google oder Facebook gehen“, sagt Franz Blach, Direktor beim Trendforscher Ideo. „Der Vorteil aus Sicht der Werbetreibenden ist, dass Apple, Google, Amazon und Spotify, weil sie Kunden aktiv in den Auswahlprozess der Inhalte einbinden, viel mehr werberelevante Daten sammeln können als TV-Sender oder Printverlage “, sagt Blach.
„Die traditionellen Anbieter haben es versäumt, konkurrenzfähige Gegenangebote aufzubauen“, sagt Bird von McKinsey. Wer will schon eine halbe Million für eine Kampagne ausgeben, bei der man nicht weiß, wen man erreicht, wenn Google oder Apple genau das haarklein darlegen?
Google hat über YouTube 90 Prozent Marktanteil beim Video-Streaming, de facto ein Monopol, werbefinanziert und deshalb gratis. Noch finden sich dort vor allem kurze Schnipsel und Amateurvideos, die von Nutzern lizenzfrei hochgeladen werden. Google wird seinen populären Web-Streaming-Kanal aber zum interaktiven Musik- und TV-Sender ausbauen, schließt bereits Lizenzverträge mit professionellen Anbietern. Dabei nutzt Google seine Marktmacht.
Individualisierbare TV-Angebote sind die Zukunft
Nachdem es sich mit den drei großen Musiklabels geeinigt hatte, setzte es die restlichen (rund 800 kleineren) unter Druck: Wer die Bedingungen nicht annimmt, dem droht Google mit der Löschung seiner Inhalte auf YouTube. „Das zeigt die Richtung“, sagt McQuivey, „Google und Amazon brauchen die Inhalte gar nicht selbst zu besitzen; es genügt, die Schnittstelle zum Konsumenten zu beherrschen, um den Inhalte-Anbietern die Bedingungen zu diktieren.“
Fondsmanager Dreide geht noch weiter: „Wer die Schnittstelle zum Nutzer hat, sei es iPhone, Google-TV oder Amazons Kindle für Bücher, der kann dort früher oder später eine Art Inhalte-Maut erheben, einen Teil der Einnahmen für das Bereitstellen der Infrastruktur verlangen.“
Zusätzlich geht es um Daten, die sich gewinnbringend verkaufen lassen. Wer alle interaktiven Möglichkeiten etwa von Amazon, YouTube oder Spotify nutzt, hinterlässt dabei eine Fülle von interessanten Daten für die Werbeindustrie: Wer hört wann welche Musik? Wer folgt wessen Listen? Spotify erforscht zusammen mit Universitäten, welche Musik bestimmte Stimmungen verstärkt. Werbeagenturen sind begeistert.







Sollte das globale Experiment der Musikbranche mit All-inclusive-Abos erfolgreich sein, „werden andere Medien folgen“, meint Bird von McKinsey. Schon heute nutzen 40 Millionen Deutsche Video-Streaming im Netz, meist gucken sie dabei YouTube-Videos oder TV über Anbieter wie Zattoo auf dem PC. Auch die Sender selbst, von ARD bis RTL, streamen einen Teil ihres TV-Programms im Netz. „Aber das ist nicht die Zukunft“, sagt Investor Burchart, „die gehört nicht dem Konsum des normalen TV-Programms am PC, sondern den voll individualisierbaren, interaktiven TV-Abos, die TV-Serien und Filme in unbegrenzter Vielfalt anbieten – analog zu Spotify oder Simfy bei der Musik.“
McQuivey sieht das ähnlich: „Sie sind kundenfreundlicher“, sagt der Marktforscher, „man kann seine Lieblingsserie schauen, wenn man Zeit und Lust hat, nicht, wenn Fox oder CBS sie zufällig senden. Wer die Auswahl und Individualität von TV-Streaming kennt, geht nicht zurück zum normalen TV-Programm.“
TV nur noch über das Netz
Der Bezahlsender Sky feiert bereits Erfolge mit seinem On-Demand-Angebot Sky-Go: Die Serie „Game of Thrones“ wurde allein von April bis Juni in Deutschland 2,3 Millionen Mal von zahlenden Kunden abgerufen. Vor allem junge TV-Zuschauer ließen sich „kaum noch mit einem vorgefertigten, alternativlosen Programm abspeisen“, sagt Viva-Gründer Gorny, der heute Medienwissenschaft an der FH Düsseldorf lehrt. Frage er Studenten, wer Musik und TV im Netz nutze, „zeigen alle auf; frage ich nach herkömmlichem TV, ist es noch die Hälfte, bei Zeitungen geht die Quote gegen null“.
TV-Angebote im Internet werden heute noch hauptsächlich in den USA genutzt, wo es dank der weiten Verbreitung des Kabel-TV ein bandweitenstarkes Netz gibt. Marktführer Netflix startet im September in Deutschland. Die Konkurrenten Hulu und WatchEver, eine Tochter von Vivendi-Universal, wachsen schnell. Auch Amazon mischt schon mit: Über Amazon Prime können Kunden Filme downloaden und elektronische Bücher leihen – für nur 100 Dollar pro Jahr.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die neue Art des Fernsehens im Rest der Welt durchsetzt. „Die TV-Branche wird überrollt, sobald ein schnelles, mobiles Netz flächendeckend verfügbar ist“, meint Fondsmanager Dreide. Neue Geräte – UltraHD oder 4K genannt – werden leichter sein und ein noch besseres Bild haben als die heutigen HD-Flachbildfernseher. „Sie werden Spielkonsole, TV, Radio, Computer und Musikanlage in einem sein“, sagt Dreide.






















