






Ein höherer Frauenanteil tut der Finanzbranche gut:
"Does Female Management Influence Firm Performance? Evidence From Luxembourg Banks" von Christoph Winnefeld, Ökonom bei der Luxemburger Finanzaufsicht und Dozent an der Hochschule Trier, die Wissenschaftler Regina Reinert und Florian Weigert, Universität St. Gallen.
In ihrem kürzlich erschienenen Forschungspapier werteten sie die Daten von 264 Luxemburger Kreditinstituten aus den Jahren 1999 bis 2013 aus. Die Zahlen belegen einen direkten Zusammenhang zwischen dem Anteil von Frauen in Führungspositionen und dem Geschäftserfolg von Banken – und zwar eindeutig. So verbesserte eine zehnprozentige Erhöhung des Frauenanteils im Top-Management die jährliche Eigenkapitalrendite der Banken um durchschnittlich drei Prozentpunkte.
Die erfolgreichsten Banken hatten dabei einen Frauenanteil im Management von 20 bis 40 Prozent. „Banken sind für die Zukunft besser gerüstet, wenn sie mehr Frauen in Vorstände und Managementpositionen bringen", schlussfolgern die Autoren. Das zahlte sich vor allem in den Jahren zwischen 2007 und 2009 aus: „In der Finanzkrise haben Banken mit höherem Frauenanteil besser abgeschnitten", so Christoph Winnefeld, „der positive Zusammenhang ist fast doppelt so stark wie in Zeiten stabiler Märkte."
Mit mehr Frauen würde der Kapitalmarkt weniger übertreiben:
"Thar 'She' blows? Gender, Competition, and Bubbles in Experimental Asset Markets", von Catherine C. Eckel and Sascha C. Füllbrunn, Texas A&M University
Abstract: Do women and men behave differently in financial asset markets? Our results from an asset market experiment using the Smith, Suchaneck, and Williams (1988) framework show marked gender difference in producing speculative price bubbles. Using 35 markets from different studies, a meta-analysis confirms the inverse relationship between the magnitude of price bubbles and the frequency of female traders in the market. Women’s price forecasts also are much lower, even in the first period. Additional analysis shows the results are not due to differences in risk aversion, personality, or math skills. Implications for financial markets and experimental methodology are discussed.
Hinterfragen Sie sich selbst: Stimmen diese Klischees über Frauen und Männer im Job?
Studien zeigen: Schon kleine Mädchen bevorzugen flache Hierarchien – keiner soll sein Gesicht verlieren. Chefinnen-Gehabe wird abgestraft. Jungs aber testen schon früh Hierarchien – und bleiben im Job dabei: Arbeit ist Wettkampf, Karriere heißt Konkurrenten killen.
Viele Frauen lehnen Machtgerangel ab, streiten lieber um der Sache willen. Männer kämpfen oft nicht um Inhalte, sondern um die Deutungshoheit.
Frauen landen oft entweder auf unwichtigen oder sehr wackeligen Stühlen, auf denen die Gefahr des Scheiterns besonders groß ist. Nicht, weil sie besonders gute Krisenmanager wären – sondern weil Männer Frauen eher ranlassen, wenn der Karren tief im Dreck steckt.
Auch unfähige Männer treten oft mit breiter Brust auf. Fähige Frauen machen sich oft klein, nehmen Dinge persönlich, haben Angst vor zu viel Verantwortung.
Immer mehr Frauen arbeiten, aber an die Spitze von Unternehmen und Banken schaffen es nur sehr wenige:
"Weiterhin kaum Frauen in den Vorständen großer Unternehmen - auch Aufsichtsräte bleiben Männerdomänen" von Elke Holst und Anja Kirsch (DIW Wochenberichte 4/2015)
Abstract: Die Vorstände großer Unternehmen in Deutschland befinden sich nach wie vor fest in Männerhand: Ende 2014 lag der Frauenanteil in den Vorständen der Top-200-Unternehmen in Deutschland bei gut fünf Prozent. Das entspricht einem Plus von einem Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr und damit einer sehr geringen Dynamik. Die DAX-30-Unternehmen konnten mit gut sieben Prozent den höchsten Frauenanteil verzeichnen, am geringsten war er mit noch nicht einmal drei Prozent bei den MDAX-Unternehmen. Häufiger sind Frauen in den Aufsichtsräten vertreten: In den Top-200-Unternehmen waren Ende des Jahres 2014 gut 18 Prozent Frauen; die DAX-30-Unternehmen schnitten mit einem Frauenanteil von knapp 25 Prozent überdurchschnittlich ab.
Die SDAX-Unternehmen wiesen mit knapp 14 Prozent nicht nur den kleinsten Frauenanteil auf, sondern mit 0,6 Prozentpunkten auch den geringsten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Wie in den Vorständen haben Frauen auch in Aufsichtsräten nur in Ausnahmefällen den Vorsitz inne. Mit dem vom Bundeskabinett im vergangenen Jahr verabschiedeten Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst dürfte sich die Besetzung zumindest von Aufsichtsratsposten durch Frauen beschleunigen. Die Quotenregelung soll ab 1. Januar 2016 gelten. Vom Gesetz betroffen wären auch Unternehmen mit Bundesbeteiligung. Hier lag der Frauenanteil im Aufsichtsrat Ende 2014 bei knapp 24 Prozent und in den Vorständen bei knapp 15 Prozent.
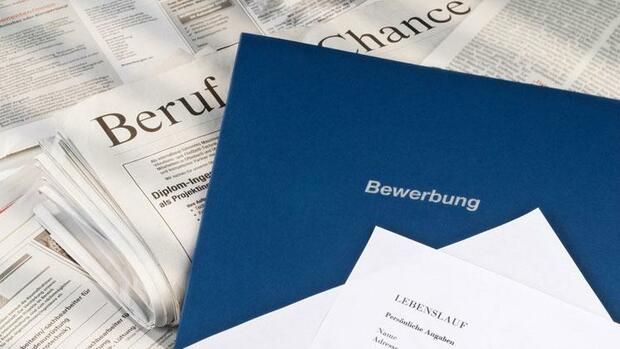

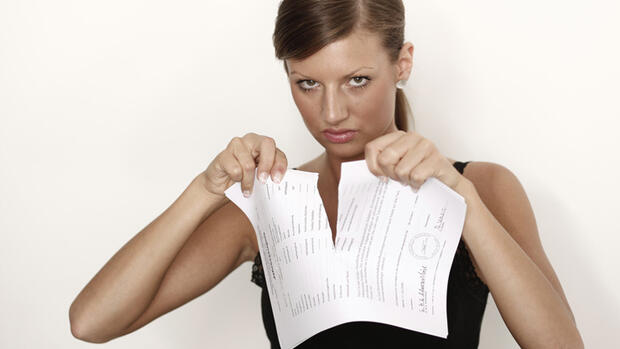




"Finanzsektor: Frauenanteile in Spitzengremien bleiben gering." von Elke Holst und Anja Kirsch (DIW Wochenberichte 4/2015)
Abstract: In den Spitzengremien von Unternehmen des Finanzsektors waren Frauen Ende des Jahres 2014 kaum häufiger vertreten als ein Jahr zuvor. In den Vorständen der 100 größten Banken und Sparkassen verharrte der Frauenanteil bei durchschnittlich knapp sieben Prozent und in den Vorständen der 60 größten Versicherungen bei 8,5 Prozent. In den Aufsichtsräten verlief die Entwicklung bestenfalls schleppend: Der Frauenanteil betrug 18 Prozent bei den Geldinstituten und gut 17 Prozent bei den Versicherungen – die Zuwächse gegenüber dem Vorjahr lagen lediglich im Nachkommabereich. In den öffentlich-rechtlichen Banken und Sparkassen waren Frauen indes häufiger in den Aufsichtsgremien vertreten als im Jahr zuvor: Mit einem Frauenanteil von knapp 19 Prozent liegen die Geldinstitute dieses Bereichs ungefähr gleichauf mit den privaten Banken (gut 18 Prozent).
Insgesamt stellen die Arbeitnehmervertreterinnen nach wie vor die Mehrheit der Aufsichtsrätinnen, allerdings hat die Kapitalseite in den vergangenen Jahren deutlich aufgeholt. Auf europäischer Ebene waren im Rat der Europäischen Zentralbank und in den Entscheidungsgremien der nationalen Zentralbanken ebenfalls vergleichsweise wenige Frauen vertreten, wobei es im Ländervergleich deutliche Unterschiede gibt. Das geplante „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ soll die Frauenanteile insbesondere in den Aufsichtsräten börsennotierter und mitbestimmungspflichtiger Unternehmen in Deutschland erhöhen.
Die Hartnäckigkeit der Strukturen könnte im Finanzsektor noch größer sein als etwa in den Top-200- Unternehmen: Obwohl mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Finanzsektor Frauen sind, nahm der Anteil der Aufsichtsrätinnen in den Banken zwischen 2006 und 2014 jahresdurchschnittlich um weniger als 0,4 Prozentpunkte zu - gegenüber 1,3 Prozentpunkten in den Top-200-Unternehmen.
"Wachsende Bedeutung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt" von Karl Brenke (DIW Wochenbericht 5/2015)
Abstract: Ein immer größerer Teil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist auf dem Arbeitsmarkt. Vor allem bei den Frauen hat die Erwerbsbeteiligung zugenommen. Je besser die Qualifikation ist, desto höher ist auch die Beteiligung am Erwerbsleben – und bei den Frauen ist das Qualifikationsniveau deutlich gestiegen und hat sich dem der Männer angenähert.
Aber auch unabhängig von der Qualifikation hat die Bereitschaft der Frauen zur Teilnahme am Erwerbsleben in allen Altersgruppen erheblich zugenommen. Bei den Männern war das im Wesentlichen nur bei den Älteren der Fall. Die Zahl der weiblichen Beschäftigten ist nahezu stetig gestiegen und hat immer neue Höchststände erreicht. Bei den Männern war der Verlauf wechselhafter, und die Zahl der Erwerbstätigen ist trotz deutlicher Zuwächse seit Mitte der letzten Dekade nur wenig höher als Anfang der 90er Jahre.
Dennoch liegen die Frauen zurück: Im Jahr 2013 stellten sie 46 Prozent aller Erwerbstätigen; noch kleiner ist mit 40 Prozent ihr Anteil am Arbeitsvolumen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass fast die Hälfte der Frauen einer Teilzeittätigkeit nachgeht. Begünstigt wurde der kräftige Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit in erheblichem Maße durch den sektoralen Wandel. Denn die Beschäftigung in Deutschland hat gerade in denjenigen Wirtschaftsbereichen stark zugenommen, in denen vergleichsweise viele Frauen tätig sind. In Sektoren wie dem produzierenden Gewerbe, in denen vor allem Männer zu finden sind, entwickelte sich dagegen die Zahl der Arbeitsplätze weniger günstig.




















