Hans Rudolf Herren: "Spätes Umdenken"
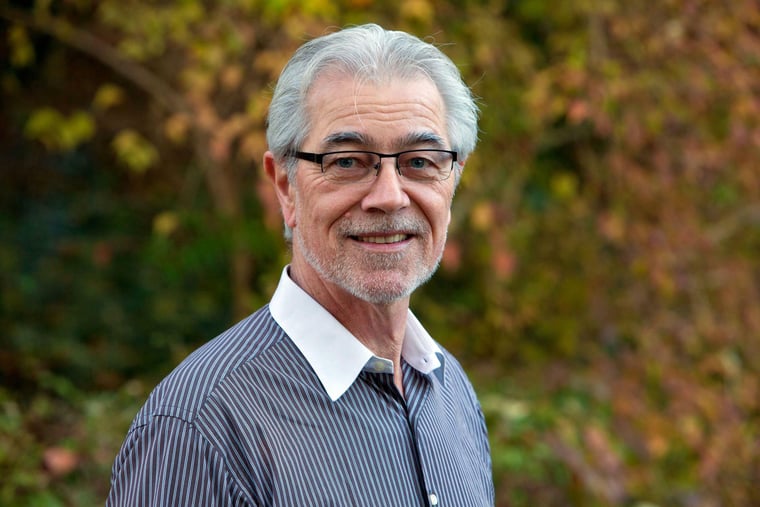
Der Schweizer Agrarforscher Hans Herren im Interview mit WirtschaftsWoche: Ohne Bio-Pflanzenschutz wird die Welt nicht satt.
Herr Herren, Sie haben in den Achtzigerjahren mit einer genialen Idee rund 20 Millionen Menschenleben gerettet: Als eine spezielle Laus-Art vier Fünftel der Ernte des afrikanischen Grundnahrungsmittels Maniok zu vernichten drohte, bekämpften Sie sie mit einem anderen Insekt, das die Läuse umbringt. Wie kamen Sie darauf?
Die Idee stammte nicht von mir alleine. Als ich in Zürich 1977 über das Thema der biologischen Schädlingsbekämpfung meine Doktorarbeit schrieb, sahen Forscher weltweit, dass die chemischen Keulen auf den Äckern immense Schäden bei Mensch, Tier und der Umwelt anrichteten – und über die Jahre an Wirksamkeit verloren. So war auch der Maniok-Schmierlaus, die in den Siebzigerjahren aus Südamerika nach Afrika eingeschleppt wurde, mit chemischen Giftstoffen nicht mehr beizukommen. Ich hatte Glück, eines der führenden Agrarforschungsinstitute Afrikas – das International Institute of Tropical Agriculture in Nigeria – stellte mich ein, um eine biologische Alternative zu entwickeln.
Wie sah sie genau aus?
Wir fanden in Südamerika, der Ursprungsregion von Maniok und Maniok-Schmierlaus einen natürlichen Feind des Schädlings – eben jene Schlupfwespe. Wir überprüften, ob sie anderen Insekten schadet. Dann züchteten wir die Tiere in großem Stil, setzten sie in 24 afrikanischen Ländern aus, und die Sache hat funktioniert.
Es hat zwar fast 30 Jahre gedauert, aber heute wenden nicht nur Bauern in der Dritten Welt oder Biolandwirte die biologische Schädlingsbekämpfung an – auch die Chemieindustrie setzt nun auf nützliche Insekten und Spinnentiere, um Schädlingen den Garaus zumachen. Freut Sie das?
Natürlich finde ich es gut, wenn auch die Verfechter des chemischen Pflanzenschutzes endlich einsehen, wie sinnvoll und effektiv biologische Abwehrsysteme sind. Ich bin überzeugt: Die Landwirtschaft wird sich weltweit nur mit solchen preiswerten und nachhaltigen biologischen Mechanismen so stärken lassen, dass die Welternährung langfristig gesichert ist. Aber ich traue der Sache nicht. Denn die weltgrößten Chemiekonzerne kaufen gerade alles auf, was Erfolg im biologischen Pflanzenschutz hat.
Wo ist da der Haken?
Na, es wäre nicht das erste Mal, dass eine mächtige Industriesparte sich unliebsame Konkurrenten einverleibt, um deren innovative Ansätze auszubremsen.

Saftig, knackig, gesund? Obacht, meint die Umweltorganisation Greenpeace, denn frisches Obst und Gemüse enthält nicht nur viele Vitamine, Ballast- und Mineralstoffe, sondern bringt auch unerwünschte Substanzen auf den Tisch. Das ergab eine aktuelle Auswertung von mehr als 22.000 Proben der deutschen Lebensmittelüberwachung aus den Jahren 2009 und 2010. Die Ergebnisse, in einem Einkaufsratgeber für Obst und Gemüse zusammengefasst, sind nicht immer appetitlich...

Paprika
Auch wenn momentan darüber diskutiert wird, dass Bio-Lebensmittel nur wenig gesünder als konventionelles Essen sind: Sicher ist, dass sie bei der Belastung mit Pestiziden deutlich besser abschneiden. Die Auswertung von Greenpeace hat ergeben, dass vor allem Paprika aus der Türkei die gesundheitlich bedenklichen Konzentrationen besonders häufig überschreitet. Über 20 Pestizide fanden die Experten in dem Gemüse. Das Online-Magazin „Utopia“ berichtet davon, dass beim Paprikaanbau oft die gefährliche Chemikalie Ethephon verwendet wird, um das Gemüse schneller einzufärben. Im menschlichen Körper soll Ethephon wie ein Nervengift wirken.

Tafeltrauben
Auch Tafeltrauben aus der Türkei enthalten im Schnitt zu viele Pestizide. Darauf weist neben Greenpeace auch das Bundesamt für Verbraucherschutz hin. Nicht selten lassen sich Spuren von zehn Pestiziden in den Trauben nachweisen. Bei Tafeltrauben aus Deutschland sind es im Schnitt weniger als fünf.

Birnen
Und auch in Birnen, die aus der Türkei importiert werden, finden sich Substanzen, die den Umweltschützern Sorgenfalten auf die Stirn treiben. In ihrer Analyse konnten die Greenpeace-Experten im Schnitt zehn Pestizide finden.

Grünkohl
Auch wenn das Wintergemüse Grünkohl nicht jedermanns Sache ist: spätestens wenn man sich die Belastungen mit Pestiziden ansieht, kann einem der Appetit vergehen, denn häufig werden die gesetzlichen Höchstmengen für Pflanzenschutzmittelrückstände überschritten.

Weinblätter
Ob türkisch, griechisch oder orientalisch: Weinblätter bereichern die mediterrane Küche. Allerdings sind auch sie besser mit Vorsicht zu genießen. Darauf weist die Zeitschrift „Ökotest“ hin. Das Fazit ihrer Untersuchung: Häufig lauern in den grünen Blättern so viel chemische Stoffe, dass sie den unbeschwerten Genuss völlig verderben. Die Zeitschrift sprach ein vielen Fällen sogar eine Nicht-Kauf-Empfehlung aus. Wer trotzdem darauf zurückgreifen möchte, sollte es auf jeden Fall Bio kaufen.

Kirschen
Hohe Rückstände von Pflanzenschutzmitteln tauchen regelmäßig auch in Süß- und Sauerkirschen auf. Von Kirschen aus konventionellem Anbau sollte man lieber die Finger lassen und sie statt dessen aus Nachbars Garten oder vom Biomarkt naschen.

Kopfsalat
Grün, knackig, gesund? Sollte man meinen, denn immerhin 4,8 Kilogramm essen die Deutschen pro Kopf durchschnittlich im Jahr. In regelmäßigen Abständen untersucht Greenpeace auch Kopfsalat. Nicht den aus Omas Garten, sondern Produkte aus Gewächshäusern und Riesenfeldern. Fast immer sind die Ergebnisse dabei erschreckend, viele Salatproben enthalten zunehmend mehrere Pflanzenschutzmittel. Dass viele Pestizide parallel eingesetzt werden liegt daran, dass sich so die Überschreitung der Höchstmenge bei einem einzigen Stoff vermeiden lässt.
Wie gesund Salat wirklich ist, damit hat sich auch das WDR-Fernsehen beschäftigt. Die Zusammenfassung des Beitrags lesen Sie hier.

Erdbeeren
Auch bei der kalorienarmen Vitamin-C-Bombe sind Bio-Erdbeeren oft die gesündere Wahl. Konventionelle Erdbeeren sind oft mit Pflanzenschutzmitteln behandelt, die sie resistent gegen Ungeziefer und Schimmel machen sollen. Sieben Pestizide fanden die Greenpeace-Experten auf Erdbeeren aus Belgien, auf deutschen vier.

Gurken
Gesunde Salatgurke? Nicht immer, denn im konventionellen Anbau werden sie häufig mit Fungiziden, das sind Anti-Pilzmittel, behandelt. Bio-Gurken weisen hingegen nahezu gar keine Pestizid-Rückstände auf.

Äpfel
Stark, groß, lecker - aber sind Äpfel auch unbedenklich? Während Äpfel aus dem Biolandbau nahezu frei von Pestiziden sind, weisen Tester der Zeitschrift „Öko-Test“ darauf hin, dass vor allem konventionelle Produkte aus Südamerika problematisch sind. Trotzdem gibt es auch gute Nachrichten, denn der aktuelle Apfel-Test zeigt, dass viel weniger gespritzt wird und die meisten Früchte, die man hierzulande kaufen kann, frei von problematischen Rückständen sind.

Spinat
Spinat macht nicht nur den Comic-Helden Popeye stark, sondern verhilft auch Sportlern zu mehr Muskelkraft. Verantwortlich soll das enthaltene Nitrat sein. Allerdings gilt auch hier wie so oft: Die Dosis macht das Gift. Häufig wird dem Boden Nitrat als Düngemittel zugesetzt, um den Ertrag der Ernte zu steigern. Im Körper kann der Stoff mit Keimen dann in das krebserregende Nitrit umgewandelt werden. Vor einigen Jahren fand Stiftung Warentest sogar Listeriene in Spinat, ein Stoff aus Tierkot, schreibt das Magazin „Utopia“. Bio-Spinat sei in dem Test dabei deutlich besser weggekommen.
Wenn die Bayers, Syngentas und BASFs dieser Welt tatsächlich, entgegen Ihrer Befürchtungen, den biologischen Pflanzenschutz als Goldesel entdeckt hätten?
...wäre das fast zu schön, um wahr zu sein. Denn bisher hat die biologische Schädlingsbekämpfung für weltweit agierende Konzerne immer Nachteile gehabt: Sie ist vergleichsweise kompliziert, biologische Systeme sind oft nur lokal einsetzbar – und ihre Gewinnmargen liegen im Vergleich zu Spritzmitteln extrem niedrig. Der Witz an der biologischen Schädlingsbekämpfung ist ja, dass sie nachhaltig ist und nicht ständig neue Umsätze generiert: Die 1,6 Millionen Schlupfwespen, die wir zwischen 1982 und 1993 in Afrika gegen die Maniok-Schmierlaus ausgesetzt haben, bilden heute eine stabile Population. Die hält die Schmierlaus nun in Schach. So ein sich selbst regulierendes System ist aber kein lukratives Geschäftsmodell für ein Unternehmen.
Andererseits begehren Verbraucher immer heftiger gegen mögliche Rückstände von Spritzmitteln auf. Zugleich verlagert sich die Obst- und Gemüseproduktion vermehrt in Gewächshäuser. Damit scheinen die Biowaffen doch auch in der konventionellen Landwirtschaft ökonomisch sinnvoll zu sein.
Ja, der Trend zum Anbau in Gewächshäusern hat einiges verändert, das stimmt. Vielleicht bin ich nach Jahrzehnten strikter Ablehnung durch die Chemiekonzerne auch einfach zu pessimistisch. Bisher war es leider in vielen Entwicklungsländern so, dass bestehende biologische Systeme der Schädlingskontrolle durch Chemie ersetzt wurden, sobald die Bauern sie sich leisten konnten. Statt eines Fruchtwechsels setzten sie dann auf Monokulturen, eine ideale Einflugschneise für Schadinsekten. Ein Umdenken beginnt oft erst nach Jahrzehnten, wenn die chemischen Waffen stumpf geworden sind.
Bricht also jetzt das Zeitalter des biologischen Pflanzenschutzes an?
Das hoffe ich sehr – und dafür setze ich mich mit meiner Stiftung Biovision in zahlreichen Projekten ein. Aber ich ärgere mich immer wieder, wenn nicht mal die vorhandenen Mittel genutzt werden. Etwa als im Sommer 2012 Heuschrecken die Ernten im Sudan bedrohten, hätte die Welternährungsorganisation die Tiere mit biologischen Wirkstoffen frühzeitig am Schwärmen hindern können. Stattdessen wartete sie, bis die Schwärme auf den Feldern einfielen – um sie erst dann mit teuren Insektenschutzmitteln niederzuknüppeln.













