Natur: Wenn Städter der Pflanztrieb überkommt

Pflanzbad. Im Allmende-Kontor auf dem Flughafen Tempelhof fliegen heute Bienen.
Die Fleischtomate kennt jeder. Was aber ist eine Fischtomate? Eine neue Paradeiser-Sorte in Fischform? Oder andersrum: Was ist ein Tomatenfisch? Ein Fisch, der sich von Nachtschattengewächsen nährt? Fast. Der Tomatenfisch ist ein Berliner Wassertier aus der Familie der Nilbarsche (tilapia niloticus metropolis), das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 800 000 Euro gefördert und in Aquakulturen in handelsüblichen Schiffscontainern gezüchtet wird. Seinen Namen verdankt der Tomatenfisch einem Miniaturgewächshaus, das auf dem Container thront und in dem per Hydrokultur Tomaten aufgezogen werden.
Der Clou der Kombifarm besteht zum einen darin, dass das Wasser in ihr zirkuliert. So werden die Stoffwechselprodukte der Fische als Pflanzendünger verwendet. Das in der Fischzucht frei werdende Kohlendioxid wird von den Tomaten gebunden. Der Tomatenfisch kann ohne besondere Sachkenntnis gezüchtet werden: auf Parkplätzen oder in Hinterhöfen. Mit 25 000 Euro ist man dabei im Agrarbusiness. Kein Pappenstiel, aber immerhin: Der Hersteller verspricht eine Garantie auf System und Teile, eine regelmäßige Wartung und eine jährliche Ernte von 330 Kilogramm Tilapia und 400 Kilogramm Tomaten.
Thema für die Wissenschaft
Der Hersteller, das ist die Berliner Firma Efficient City Farming (ECF), ein dreiköpfiges Startup, keine drei Monate jung: Nicolas Leschke, Karoline vom Böckel und Christian Echternacht. Das Trio hat sich den Exklusivvertrag für den Vertrieb der Tomatenfischfarmen gesichert, die der Biowissenschaftler Werner Kloas und sein Team am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei entwickelt haben – und läutet damit so etwas wie die zweite Phase des „Urban Gardening“ ein.

Christa Müller (Hg.): Urban Gardening
Oekom Verlag
Der Band versammelt 22 Aufsätze verschiedener Autoren und streift nahezu alle Facetten des Stadtgärtnerns vom Erholungsnahraum bis zur Ernährungssouveränität. Die Qualität der Beiträge schwankt naturgemäß; die meisten sind analytisch, die wenigsten geschwätzig. Der Schwerpunkt liegt auf zeitdiagnostischen Analysen. Interessant sind Beispiele aus Berlin, Leipzig, Dessau – und Kuba. (Oekom)
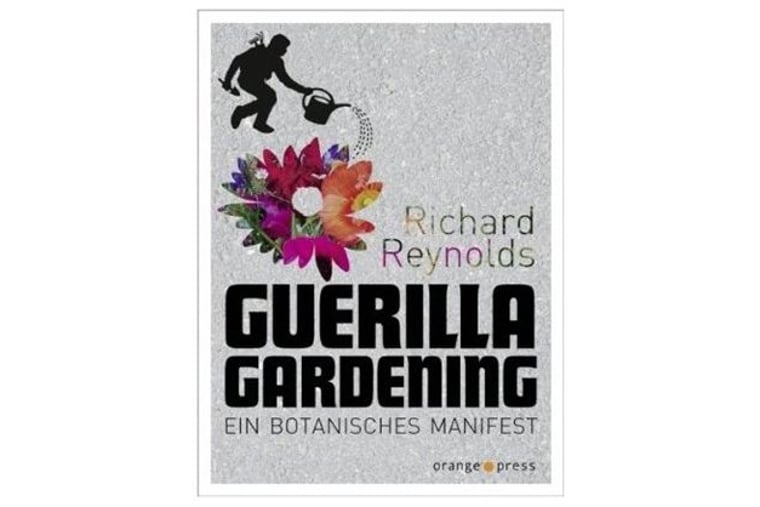
Richard Reynolds: Guerilla Gardening - Ein botanisches Manifest
Orange Press
Richard Reynolds ist ein junger Mann der Tat – und leider merkt man das seinem Buch an. Der Brite vergleicht illegale Großstadtpflanzereien mit den Taten von Mao und Che Guevara – und sieht im Grün vor allem eine Farbe des Widerstands: „Guerilla Gardening ist eine Schlacht um die Ressourcen, ein Kampf gegen Landmangel, gegen ökologischen Raubbau... eine Schlacht, in der Blumen die Munition sind.“
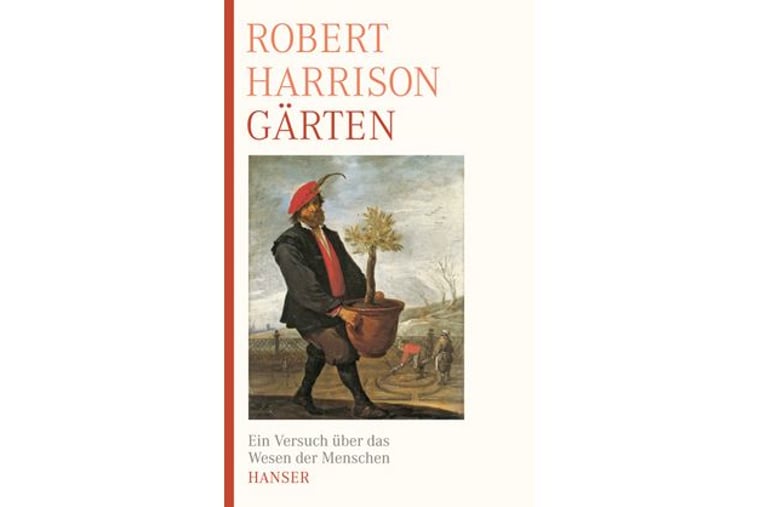
Robert Harrison: Gärten - Ein Versuch über das Wesen der Menschen
Hanser Verlag
Vielleicht das schönste Gartenbuch auf dem Markt. Der amerikanische Romanist deutet Sorge und Hege als anthropologische Grundeigenschaften – und während er das Paradies (Natur) vom Garten (Kultur) scheidet, uns die Göttin Cura vorstellt und von Zufluchtsorten erzählt (Boccacios Dekameron), in denen der Mensch vor den Bedrohungen der Welt geschützt ist, nimmt sein „Versuch über das Wesen des Menschen“ Gestalt an.

Sabine Frank: Mein Garten ist mein Herz
DuMont
Bei dieser „Kulturgeschichte der Gärten in Deutschland“ handelt es sich um einen großformatigen, reich bebilderten Band, dessen Schwerpunkt auf der deutschen Klassik und Romantik liegt. Es geht um von Siebold und Fürst Pückler, um von Linné und Lenné, um Sanssouci, die chinesische Mode und den Englischen Garten in München. Ein hübsches und informatives Coffeetable.
Den ersten Asphalt-Begrünungsinitiativen ging es vor einigen Jahren um Dinge wie den Erhalt und den Anbau innerstädtischer Naturräume, um multikulturelle Nachbarschaftsbegegnungen oder die Verbesserung des städtischen Mikroklimas, um gesunde Ernährung und minimierte Transportkosten, um ein bisschen Subsistenzfolklore, Gemeinschaftsgeist und natürlich auch um ein Statement gegen die Marktmacht der Nahrungsmittelkonzerne.
Heute treibt das Thema vor allem die Wissenschaft um. Die Soziologen fragen, ob es sich bei den Innenstadt-Gärten um Räume für „soziale Nahbezüge“ handelt, in denen Kulturen der „Sorge“ und der „Zuwendung“ aufblühen – und sie rätseln, ob es sich beim Asphaltgärtnern um eine buchstäblich geerdete Tätigkeit handelt, mit der vor allem die jungen Bürger den Rationalitäts- und Flexibilitätszwängen des neoliberalen Alltagsregimes entkommen wollen. Die Städteplaner wiederum wollen wissen, ob es sich bei der Begrünung von gepachteten Brachflächen oder von „Guerilla-Gärtnern“ gesetzeswidrig in Besitz genommem Land um eine Art von offenem Bürgerbeteiligungsprozess handelt.

Grünes Rathaus. In Downtown Chicago wachsen Gärten auf der City-Hall.

Margeritenzucht in einem Tokioter Bürogebäude. Das sogenannte „Urban Farming“ könnte ein wichtiger Produktionszweig der Zukunft sein.
Die Sehnsucht nach Grünem im Grauen, nach Blüten zwischen Beton, nach Frieden auf Balkonien ist dabei zunächst völlig unpolitisch. Raus in die Natur bedeutet in Metropolen, eine halbe Tagesreise zu machen; da ist es erholsam, einen Hauch Natur in der Nachbarschaft zu wissen. Balkon-Tomatengärtner beackern im Kleinsten ihren Selbstversorgertraum, den ein Land wie Deutschland im Großen mit seiner intakten Struktur von Kleingartenvereinen lebt. Zwischen Bahnschienen und Ausfallstraßen mag der deutsche Michel piefig aufblühen, das ändert aber nichts an der immer größeren Zahl von jungen Familien, die eben genau dort ein Fleckchen Flucht pachten wollen.
In Metropolen wie Chicago, Buenos Aires oder Tokio, in deren Zentren kaum Platz für Grün ist, erleben Gärten auf den Dächern von Hochhäusern seit Jahren eine wundersame Renaissance. In New York entschied sich die Stadtverwaltung eine stillgelegte Bahnstrecke im Süden Manhattans zum begrünten Spazierweg umzubauen. Der Franzose Patrick Blanc verwandelt in Städten wie Paris ganze Hauswände mit seiner Vertikal-Botanik in sogenannte hängende Gärten. Doch bei Stadtverschönerungsaktionen bleibt es nicht.
Grüne Geschäftszweige
Naturwissenschaftler, zum Beispiel am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) in Oberhausen, suchen Fassaden und Dächer urbar zu machen, um die Flächenversiegelung und den extensiven Wasserverbrauch der traditionellen Landwirtschaft durch den Aufbau von urbanen Agrikulturen und Hochhausfarmen zu minimieren. Und junge Unternehmer wie das Trio von Efficient City Farming nutzen die Erträge der Forschung, um mit „Urban Gardening“ auf einen grünen Geschäftszweig zu kommen.
In Berlin geht schon Mitte Mai die erste Tomatenfischfarm in Betrieb. Gleich vor dem Eingang eines Berliner Restaurantbetreibers, der sich von Tomaten ohne ökologischen Fußabdruck und garantiert düngemittel-, medikament- und kohlendioxidfreiem Fischverzehr Zulauf verspricht. Und das soll erst der Anfang sein. Denn geschäftlich interessant wird der Tomatenfisch erst, wenn Stadtfarmen entstehen, Produktionsstätten, die 20 mal 50 Meter messen und beispielsweise von Lebensmittelketten betrieben werden. Das dazugehörige Parkplatzareal, so die Idee, wird überdacht, ein Teil für die Fischproduktion abgetrennt – und auf dem Dach werden nicht nur Tomaten, sondern auch frische Paprika, Kohlrabi und Kräuter geerntet.
Zukunftsmusik? Keineswegs. In den USA hat die Firma Brightfarms gerade eine Kooperation mit der Supermarktkette McCaffrey’s abgeschlossen, um in seinen schlüsselfertig verkauften Hydro-Gewächshäusern ultra-local Salate, Tomaten und Kräuter zu produzieren und in the freshest imaginable way ins Regal zu bringen.
Armin Werner kann sich gut vorstellen, dass Dachgewächshäuser und Tomatenfischcontainer schon bald zur realen Alltagswelt des „Urban Gardening“ gehören – nicht zuletzt, weil sich die Marketingabteilungen von Aldi bis Wal-Mart dafür interessieren könnten. Der Institutsleiter für Landnutzungssysteme am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung arbeitet im Rahmen des BMBF-Wissenschaftsjahrs 2012 („Zukunftsprojekt Erde“) an einer Bestandsaufnahme der jungen Bewegung, rechnet ihre wirtschaftlichen Potenziale hoch, sammelt Forschungswissen und stellt es einem wöchentlich wachsenden Netz von Wissenschaftlern, Architekten und Städteplanern zur Verfügung.
Aber Werner sagt auch, dass er sich insgesamt noch etwas schwertue mit der Vorstellung, „Urban Farming“ könne ein wichtiger Produktionszweig der Zukunft sein. Die Effizienz der traditionellen Landbetriebe sei groß, sagt Werner, und die Anforderungen an Hygiene und Lebensmittelsicherheit in kleinen Stadtfarmen proportional viel teurer, weshalb Stadtfarmer allenfalls mit Exotika, etwa speziellen Kräutersorten für die Spitzengastronomie oder eben „ultrafrischen“ Gemüseprodukten, punkten könnten.
Wunsch zu gärtnern
In Nordamerika hat „Urban Gardening“ bisweilen eine andere Bedeutung. Während das Thema in Kanada vor allem Designzeitschriften ziert, in denen es um Loftbegrünung und emissionsfreies Hochhaus-Wohnen geht, macht es in den USA als eine Art existenzielle Grassroot-Bewegung in verarmten Industriestädten wie Detroit die Runde: Man erinnert an die städtischen „Victory Gardens“ während des Zweiten Weltkriegs und preist die Vorzüge der Subsistenzwirtschaft als eine Art Sozialprogramm für Arme. In Deutschland indes, glaubt Armin Werner, sei vor allem der soziale Aspekt entscheidend: „Es geht um den Stadtgarten, sicher, aber vor allem geht es ums Stadtgärtnern.“
Und wo die Blumen stehen, dürfen die Bienen nicht fehlen. 600 Hobby-Imker zählt allein Berlin. Manchmal wird auch dort geimkert, wo weit und breit nicht eine Blüte ist. Wie auf dem Dach des Pullman Hotels in Köln. Der Haus-Imker ist Rolf Slickers, Direktor des Hotels. Seine Gäste haben etwas von Slickers Hobby: Auf dem Frühstücksbüfett steht Honig aus den hoteleigenen Bienenstöcken.












