E-Mail-Flut: Mit der Zahl der Mails steigt der Stresspegel
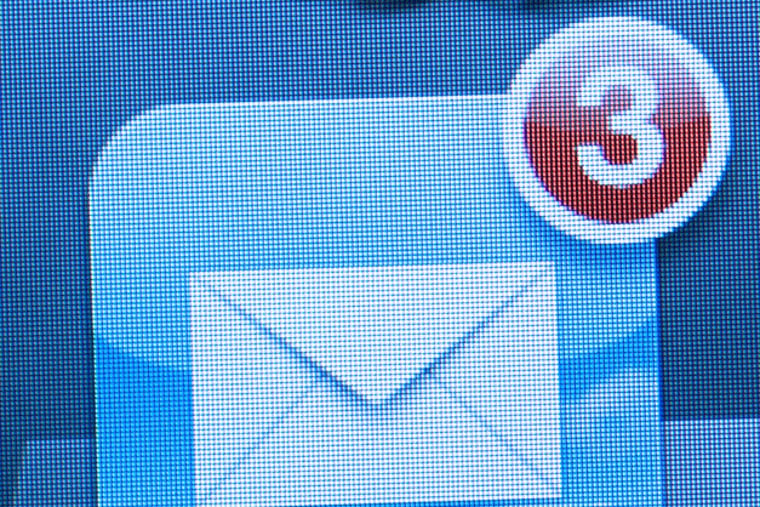
Notwendigkeit prüfen
Das sollte immer die erste Frage sein, bevor Sie lostippen. Unwichtige Mails kann man unbeantwortet ignorieren. Und manchmal ist eine Angelegenheit viel schneller erledigt, indem man den Kollegen zwei Büros weiter kurz persönlich anspricht oder zum Telefonhörer greift.

Betreff formulieren
Ein klarer Betreff erhöht die Chance, dass eine E-Mail nicht im Spam-Ordner in Vergessenheit gerät oder ungelesen im elektronischen Papierkorb landet. Formulieren Sie den Betreff also schon mit dem Ziel, dem Empfänger einen Leseanreiz zu schaffen. Lange Schachtelsätze sind unangebracht. Meistens genügt schon ein Stichwort, das den Inhalt beschreibt. Der Klassiker: "Kurze Frage".

Layout beachten
Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund ist am besten leserlich. Außerdem machen Sie es dem Leser mit einer verschnörkelten Schriftart unnötig schwer. Versuchen Sie außerdem, Ihre E-Mail in Blöcke zu strukturieren. So kann Ihr Anliegen wesentlich besser herausgestellt werden. Abkürzungen und Verklausulierungen sind eine Zumutung, wenn der Leser nicht auf Anhieb versteht, worum es eigentlich geht.

Priorität einstellen
Wenig glaubwürdig ist auf Dauer, wenn Sie Ihre Mails immer mit einer hohen Priorität versehen. Dies sollten Sie wirklich nur machen, wenn Ihre Nachricht sehr wichtig ist und einen hohen Dringlichkeitswert hat.

Anrede anpassen
Genauso wie in einem Geschäftsbrief ist in einer E-Mail auf die passende Anrede zu achten. Auch, wenn eine E-Mail formloser erscheint - Fehler sind auch hier schnell passiert. Im Zweifel ist ein „Sehr geehrte/r“ immer passend. Alternativ ist ein „Guten Tag“ auch nicht falsch. Die Anrede „Liebe/r“ sollte man allerdings nur wählen, wenn man sich gut kennt. „Hallo“ klingt zu flapsig. Völlig ungeeignet sind „Hi“ oder „Hey“.

Kürze beachten
Kaum jemand liest lange Mails. Ein Blogbeitrag bei „Mashable“ zeigt, dass meist fünf Sätze genügen, um dem Empfänger ein Ziel klar vor Augen zu führen. Auf verständliche Formulierungen sollten Sie allerdings trotzdem achten. Die Einhaltung von Grammatik, Zeichensetzung und Rechtschreibung haben in einer E-Mail immer Priorität. Am besten lesen Sie noch einmal gegen, bevor Sie auf "Senden" klicken.

Fehler vermeiden
Lange Einleitungen, die nichts mit dem Thema der Mail zu tun haben, sind vielleicht nett - lenken aber vom eigentlichen Thema ab. Smalltalk und inhaltsleere Phrasen sind in Mails meist unangebracht. Nichts zu suchen haben in geschäftlichen E-Mails ebenfalls Emoticons und Chatkürzel. Eine Empfangsbestätigung sollten Sie nur einfordern, wenn die E-Mail mit einem Einschreiben gleichzusetzen ist. Bei ironischen oder missverständlich zu interpretierenden Kommentaren ist generell Vorsicht geboten. Wenn eine E-Mail einmal versendet ist, lässt sie sich nicht mehr revidieren!

Große Anhänge vermeiden
Vermeiden Sie es unbedingt, große Datenmengen per Mail zu versenden. Denn sie verstopfen lediglich das Postfach des Empfängers - und verärgern ihn. Es gibt inzwischen genügend Alternativen, Fotos oder Dokumente anderen Personen zugänglich zu machen. Beispielsweise über einen Cloud-Service wie Dropbox.

Signatur einfügen
Die Signatur gehört zu einer E-Mail genauso wie die Anrede. Achten Sie darauf, dass Ihre Kontaktdaten vollständig sind.

Richtig verabschieden
"Mit freundlichen Grüßen" ist eine Möglichkeit, eine E-Mail zu beenden. "Viele Grüße" ist weniger formell, aber immer noch angebracht - und klingt netter als nur "Grüße". "Hochachtungsvoll" klingt zu gestelzt. Eine angepasste Grußformel wie "Mit herzlichen Grüßen nach Berlin" klingt persönlicher - und ist ratsamer als "Grüße aus Köln". Denn hier fehlt der Bezug zum Empfänger.
Alles fing harmlos an, damals vor 44 Jahren im Büro einer Computerfirma in Boston. Der Programmierer Ray Tomlinson tippte ein paar Buchstaben in seinen Computer und klickte als erster Mensch auf den Sendeknopf eines E-Mail-Programms. Die Nachricht landete kurz darauf bei ihrem Empfänger: einem anderen Computer von Tomlinson, der einige Meter entfernt stand. Die erste E-Mail der Welt war ein Selbstgespräch.
Seitdem sind einige Mails dazugekommen, viele waren vermutlich ähnlich inhaltsleer. Und es geht immer weiter: Im Jahr 2018 werden weltweit 140 Milliarden berufliche E-Mails verschickt, schätzt das Marktforschungsunternehmen Radicati Group – pro Tag.
Für Büroarbeiter sind E-Mails bisweilen eine Qual, manchmal richten sie echten Schaden an. Niemand weiß das besser als Hillary Clinton, die sich kürzlich für die dienstliche Nutzung ihres privaten E-Mail-Anschlusses als US-Außenministerin entschuldigen musste. Oder die Angestellte des Deutschen Bundestags, die im Jahr 2012 die Server überlastete. Sie schickte eine E-Mail versehentlich an mehr als 4000 Konten – weil sie auf „Allen antworten“ gedrückt hatte. Noch peinlicher war der Fauxpas der Fondsgesellschaft Aviva Investors, der 2012 per E-Mail aus Versehen alle 1300 Angestellten weltweit feuerte – obwohl er nur eine einzige Kündigung aussprechen wollte.
Für Organisationspsychologen, Informatiker und Kommunikationswissenschaftler sind E-Mails jedoch ein Glücksfall. Denn die elektronische Post erlaubt einen Blick in die Seele der Angestellten – und der gesamten Unternehmenskultur. Leider kommt die E-Mail in den meisten Studien nicht allzu gut weg.
Kein Wunder: Kaum wollen sich Angestellte konzentriert einer Aufgabe widmen, macht es pling. Aus Neugier schauen die meisten sofort ins Postfach, egal, ob unterwegs auf dem Handy oder am Rechner im Büro. Abends wissen sie vor lauter E-Mails nicht mehr, wo der Tag geblieben ist – und fühlen sich ausgelaugt. Wie viel Stress E-Mails tatsächlich verursachen, fanden Kostadin Kushlev und Elizabeth Dunn von der Universität von British Columbia heraus.
Für ihre Studie rekrutierten sie 124 Angestellte aus unterschiedlichen Bereichen. In der ersten Woche sollten sie nur dreimal täglich ihre E-Mails lesen und beantworten, ansonsten sollten sie den Posteingang ignorieren. In der zweiten Woche sollten sie hingegen so oft wie möglich ihre Mails checken.
Je mehr E-Mails, desto Stress
Jeden Tag schickten die Forscher den Teilnehmern am Ende ihres Arbeitstages einen Fragebogen. Dort sollten sie unter anderem eintragen, ob sie sich gestresst oder entspannt fühlten. Das Ergebnis: Je öfter die Angestellten am Tag Mails gecheckt hatten, desto gehetzter fühlten sie am Abend.
Wissenschaftlern zufolge liegt das auch an der besonderen Form der Kommunikation. Die schriftlichen, knappen Formulierungen erschweren die Verständlichkeit und fördern Missverständnisse. Kaum jemand kann zwischen ernsten Ansagen und feiner Ironie unterscheiden. Weder Sender noch Empfänger einer E-Mail scheinen sich bewusst zu sein, dass sich Ironie oder andere subtile Botschaften nur schwer in Textform übermitteln lassen. „Menschen überschätzen, wie gut sie mit E-Mails kommunizieren können“, sagt der Psychologe Justin Kruger von der New-York-Universität. Das gilt längst nicht nur für Ironie – sondern auch für Emotionen wie Ärger und Trauer, wie Psychologen in mehreren Experimenten zeigen konnten. Und vor allem für Humor. Einen Witz über E-Mail richtig rüberzubringen, ist noch schwieriger, als Ironie zu verdeutlichen. Trotzdem glauben auch hier die meisten Menschen, dass der Empfänger ihrer lustig gemeinten E-Mail den Humor schon versteht.
Nun fällt es vielen Menschen schon von Angesicht zu Angesicht schwer, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen – vor dem Bildschirm versagt die Empathie dann vollends. Dabei wäre sie gerade bei E-Mails notwendig. Das belegte vor einigen Jahren auch ein Experiment von Kommunikationsforschern der französischen Business School Insead. Sie ließen ihre Probanden über ein Chat-Programm an einem Verhandlungsspiel teilnehmen, bei dem jeweils zwei Freiwillige gegeneinander antraten und je nach Verhandlungsgeschick unterschiedliche Gewinne erzielen konnten.
Einigen Teilnehmern gaben die Forscher den Auftrag, die Sprache des Gegenübers genau zu analysieren und darauf zu achten, ob er zum Beispiel Emoticons oder ähnliche Symbole benutzte. Anschließend sollten sie sich an dessen Kommunikationsstil anpassen und möglichst genauso schreiben. Diese Strategie war äußerst erfolgreich. Wer den Stil seines Gegenübers besonders gut imitierte, holte bei der Verhandlung deutlich mehr für sich heraus.
Geschäftsmodell perfekte E-Mail
Auf solchen Erkenntnissen will das amerikanische Start-up Crystal ein Geschäftsmodell aufbauen. Die Gründer versprechen, die perfekte E-Mail zu schreiben. Dafür muss man der Software nur sagen, an wen die Mail gehen soll. Die Algorithmen suchen dann alles zusammen, was es über den Empfänger im Internet zu finden gibt, und erstellen daraus ein sprachliches Profil. Das Programm wertet zum Beispiel Beiträge in sozialen Netzwerken aus. Kommt jemand direkt zur Sache, oder schickt er gerne etwas Small Talk voraus? Am Ende spuckt Crystal einen detaillierten Bauplan für die richtige E-Mail an den jeweiligen Empfänger aus.
Wenn es nach dem Harvard-Psychologen Andrew Brodsky geht, sollte solche Software um eine Funktion ergänzt werden: Tippfehler zu machen. In einer Reihe von Experimenten konnte er zeigen, dass kleine Fauxpas eine E-Mail glaubwürdiger machen.
Brodsky ließ mehrere Testpersonen Mails lesen, bei denen der Absender entweder wütend oder glücklich war. In den wütenden Mails beschwerte sich ein Vorgesetzter über die verspätete Abgabe eines Berichts. Doch der Forscher legte seinen Testpersonen zwei Varianten vor: eine perfekte, eine mit Tippfehlern. Nun fragte er die Probanden, für wie authentisch sie den Absender hielten. Und siehe da: Wer Mails mit Tippfehlern gelesen hatte, glaubte dem Absender eher als jene, die einen makellosen Text bekommen hatten. Perfekte Mails würden zumindest unbewusst als künstlich wahrgenommen werden, glaubt Brodsky – und damit weniger Emotionen auslösen.
Gerade für Führungskräfte könnte es sich daher manchmal lohnen, die Mails schlampiger zu schreiben. Schon in den Sechzigerjahren konnte der US-Sozialpsychologe Elliot Aronson zeigen, dass kleine Fehler das Ansehen von Führungskräften bei ihren Mitarbeitern steigern. Die These des Forschers: Die Chefs wirken dadurch menschlicher und vertrauenswürdiger. Doch auch hier gilt: Die Dosis macht das Gift.
Absichtlich Fehler in die Mails zu streuen sei riskant, warnt Brodsky. Denn sein Experiment zeigt: Werden es zu viele Fehler, hält der Empfänger den Autor der Mail für weniger intelligent. Der Psychologe rät daher, Mails vor dem Abschicken gegenzulesen, um die gröbsten Fehler zu korrigieren. Wem doch ein Fauxpas passiert, der muss sich nicht grämen: Kleinere Ausrutscher können die Botschaft der Mail sogar verstärken.
Anders ist es jedoch mit diesem einen bissigen Satz in der Mail an den Chef, den man sich doch nicht verkneifen konnte. Jeder kennt die Verlockung, E-Mails als Wutventil zu benutzen. In den USA gibt es dafür bereits einen eigenen Begriff: „e-venting“, was so viel heißt wie „elektronisch Dampf ablassen“. Keine gute Idee. Vor allem, weil das Abreagieren auch dem Absender der Mail nicht hilft. Das zeigte ein Experiment des Psychologen Brad Bushman. Er ließ Studenten einen Aufsatz schreiben, den sie anschließend einem Prüfer vorstellen mussten. Der kritisierte sowohl Sprache als auch Inhalt.
Die Studenten hatten also gehörig Wut im Bauch, als sie zum zweiten Teil des Experimentes kamen. Dort durfte ein Teil der Probanden auf einen Boxsack einschlagen, während sie an den Prüfer denken sollten. Die anderen Teilnehmer, die ähnlich wütend waren, durften ihren Ärger nicht rauslassen. Der zweiten Gruppe ging es nachher deutlich besser. Seine Wut abzulassen bringe nichts, schloss Bushman.
Guido Hertel kennt das Phänomen. Der Organisations- und Wirtschaftspsychologe der Universität Münster rät daher zu einem Trick. „Wer seine Wut unbedingt per Mail rauslassen will, der soll das machen“, sagt Hertel, „solange er vor dem Schreiben den Empfänger löscht und die Mail nicht abschickt, sondern nur speichert.“
Dann sollte man eine Nacht drüber schlafen und die Mail erneut lesen: „Vermutlich will man sie dann nicht mehr abschicken“, sagt Hertel, „oder formuliert sie zumindest konstruktiver.“ Dass E-Mails so viel produktive Arbeitszeit zerstören, liegt Hertel zufolge daran, dass sie falsch genutzt werden.
Süchtig nach E-Mails
Kein Wunder: In einem Klassiker der E-Mail-Forschung konnte der Computerforscher Thomas Jackson von der britischen Loughborough-Universität 2002 zeigen, dass E-Mails geradezu süchtig machen. Er beobachtete mehrere Tage lang die Angestellten einer IT-Beratung. Dabei bemerkte Jackson, dass die meisten ihre Mails innerhalb von sechs Sekunden nach dem Eintreffen öffnen. So weit, so verständlich.
Das Problem war allerdings: Nach der kurzen, vermeintlich harmlosen Unterbrechung dauerte es im Schnitt 64 Sekunden, bis sie sich wieder auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrierten. Das klingt zunächst nach einer Petitesse. Doch da die Angestellten im Schnitt alle fünf Minuten von einer Mail aus ihrer Arbeit gerissen wurden, ging über den ganzen Tag ein großer Teil der Arbeitszeit durch E-Mails verloren.
Psychologe Hertel rät Unternehmen daher, E-Mail-Regeln einzuführen. Oft lasse sich die Zahl der Mails durch einfache Verhaltensänderungen reduzieren. „Ein Großteil der Mails, die jeden Tag geschickt werden, ist überflüssig“, sagt Hertel. Die vielen Ein-Wort-Mails mit „Danke, bitte, gern geschehen“ könne man meistens weglassen. Auch durch die Angewohnheit, im Zweifel die ganze Abteilung „in cc“ zu setzen, entstehen viele unnötige E-Mails .
Den Empfängern von störenden E-Mails rät Hertel, die blinkenden Benachrichtigungssymbole im Posteingang abzuschalten. „Eine E-Mail muss nicht sofort beantwortet werden. Sie ist ein Kommunikationsmittel, das extra dafür gemacht wurde, erst später bearbeitet zu werden“, sagt er. Wer seine E-Mails zum Beispiel nur zwei Mal täglich durchgeht und beantwortet, ist deutlich produktiver und zufriedener.
Eines ist jedenfalls sicher: Los werden wir die elektronische Post so schnell nicht. „Im Büro wird die E-Mail noch lange überleben“, prognostiziert Hertel. „Dafür hat sie einfach zu viele Vorteile.“









